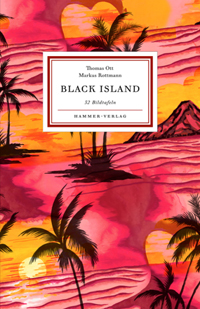Sich die Sprache geben
Eine Wanderung im Grenzgebiet.
Nach Biel reisen, auf dem Perron den nahen See erahnen, in den Strassen nach etwas gefragt werden, zufallsleicht, in einem feingestrickten, zierlichen Französisch, dann selber den Mund aufmachen – und gleich im allerersten Sich-sprechen-hören-Müssen in die Furche fallen.
Als Berner dieses Biel ganz selbstverständlich für Bienne nehmen, in Bienne ausnahmslos alle Französisch sprechen hören und sich, kaum ist ein Fuss auf Bieler Boden gesetzt, hinter einem Sprachvorhang fühlen, der radebrechend nicht zu durchdringen ist. Wenn du radebrichst, übersetzt sich dies als: Parler français comme une vache espagnole, und sternenhimmelklar wird: Kaum schmiegt sich das Französische ans Ohr, erscheint das Deutsche als Ausbund der Pedanterie, als kleinbürgerliche Visitenkarte des Ne-pas-savoir-vivre.
Erzählend von deinen sporadischen Streifzügen durch die unter- und überschiedlichsten Wälder hast du einst einer im welschen Land verwurzelten Freundin gegenüber auch ma tente erwähnt, dein Zelt, welches auf derartigen Fussvoyagen hin und wieder mitkommt, und Wochen später zeigte sich, sie hatte erstaunt geglaubt, du würdest bisweilen ausgedehnte, abenteuerliche Spaziergänge unternehmen mit ma tante, deiner sportlichen Tante. Bis heute weisst du nicht, wie sich tente von tante lautlich unterscheidet, weswegen du, wenn das Zelt mitkommt, Missverständnissen vorbeugend seither von einer Wanderung mit deinem Onkel sprichst.
An diesem milden, sonnenverwöhnten Septembernachmittag lässt du hingegen alle Verwandten zurück, entscheidest dich für leichtes Gepäck; Schlafsack, Matte, Taschenuhr, Apfelsaft – und einen Roman von Agota Kristof. Am Bahnhof von Biel/Bienne überschreitest du vorerst unbemerkt den Schrägstrich der Sprachgrenze und denkst bereits im weiter westwärts rollenden Zug sitzend an jene hübsche Föhre, die dir des Nachts irgendwo zwischen Saint-Imier und Neuchâtel hoffentlich ein Quentchen von ihrer wohlverwurzelten Geborgenheit wird leihen mögen.
Kaum steigst du in Saint-Imier aus, zeigt sich dir am Talboden, einige Etagen unterhalb der restlichen Kleinstadt, ein riesenhaftes Gebäude, das seinen klösterlichen Glanz hinausträgt in die liebliche Talschaft: Die Fabrik. L’usine. Ein machtvoller, von Autos umzingelter Bau ist es, an dem du zu Fuss vorbeiziehst, ein immenses immeuble für die heilige Arbeit, eine Uhrenfabrik als mechanischer Antrieb für eine ganze Region.
Während du mit Wanderschuhen und Rucksack und mitten im après-midi die Fabrik streifst, wirst du von einigen Arbeiterinnen gemustert, als seist du hergewandert von einem anderen Stern. Dem Stern eines arbeitsfreien Mittwochnachmittags. Wenn du usine hörst, siehst du ein U-Boot auf Tauchgang, mit dem i-Punkt als Turm, siehst deinen blondbärtigen Vater mit Lärm in den Ohren an einer ihn erschütternden Maschine stehen, mit einem Stolz, der in den 80er Jahren noch Teil des Lohnes war.
Dass Saint-Imier auch Sankt Immer heissen soll, hältst du bis heute für einen billigen Scherz, in Umlauf gehalten von tendenziell frankophoben Zeitgenossen. Wahrscheinlich ist es tatsächlich eine mauvaise plaisanterie der Geschichte, die enfin auch dafür besorgt war, die doch eher seltsam tickende Uhrenindustrie hineinzulocken in diese stillen Talschaften, in die nach Ewigkeit duftenden, immergrünen forêts de conifères, hinein in die Konferenz der Nadelbäume.
Während du l’usine hinter dir lässt und den Mauern eines malerischen Friedhofs folgst, denkst du an die Worte, die Agota Kristof über die Uhrenfabrik von Fontainemelon verloren und gewonnen hat. Durch eine Arbeit, die nur deshalb von Menschen erledigt werden muss, weil die jene Arbeit viel rationeller erledigende Maschine noch nicht gebaut oder noch nicht erschwinglich ist, wird die Würde des Menschen zerkleinert, perforiert, flachgeschmirgelt und normiert verpackt. Was mich betrifft, so stanze ich mit meiner Maschine ein Loch in ein bestimmtes Werkstück, seit zehn Jahren das gleiche Loch in das gleiche Werkstück. Damit ist alles über unsere Arbeit gesagt. Ein Werkstück in die Maschine legen, das Pedal treten. Mit dieser Arbeit verdienen wir gerade genug Geld, um uns zu ernähren, irgendwo zu wohnen und vor allem am nächsten Tag wieder arbeiten zu können.
Ein Monolith der Monotonie ist die Fabrik, und so sehr die Uhren später glänzen, so matt sind die Seelen der Arbeitenden. Wen wundert’s, wenn Agota ihre fabrikgeschädigte Hauptfigur in den Wald ziehen lässt, suizidäre Sehnsüchte mit sich tragend?
Der mit den Waldrändern flirtenden Suze folgend gelangst du nach Sonvilier, das noch im süssen Taumel der Siesta liegt. Diese Stille weiss ein hinterhöfischer Hahn zu nutzen, um derart laut und empört zu krächzen, als habe er ein Ei gelegt. Emporsteigend durch einen die schon schwächelnde Spätsommersonne mit tausend Blättern filternden Wald, ist das Dorf lediglich ein fernes Gebimmel von Kuhglocken, getaktet von einer Axt, die wieder und wieder ins Holz fährt.
Moose überwachsen hellen Kalkstein, sorglose junge Bäume setzen sich auf Felsvorsprünge, zart knirscht der Kiesel unter der Sohle. An die schroffen Kanten Kristof’scher Prosa denkst du. An den in ihrem Buch stehenden Selbstmord, der auf Französisch unendlich viel schöner, würdevoller vonstattengeht: se donner la mort. Ein Selbstmord als Geschenk, derart wertvoll, dass man es sich nur selber überreichen kann.
Germanophon beheimatet, fühlst du dich von derartigen Wendungen ertappt. Se donner la langue: Savoir-vivre heisst immer auch Savoir-parler – aber der Röschtigraben liegt dir auf der Zunge. Verdreht dir den Hals. Er ist die Schlucht zwischen dem, was du sagen möchtest, und dem, was du auf Französisch sagen kannst.
Bisweilen schwingt sich das Frankophone in dir empor zum gewichtigen Symbol für alles, was in der Fremde besser ist. Und die Fremde, sie beginnt eben schon hinter Bienne: Hätten die Welschen das Sagen, wäre die Schweiz seit 1989 ohne Armee. Hätten die Welschen das Sagen, würden wir alle ein bedingungsloses Grundeinkommen erhalten, fünf oder sechs Wochen Ferien, hätten die 35-Stunden-Arbeitswoche im Kalender und den Rotwein auf dem Mittagstisch stehen. Wir würden den Zufall lieben, nicht die Versicherung. Du wünschst dir eine andere Schweiz, und es gibt eine andere Schweiz. Leider hat sie nicht das Sagen, sie hat die Zunge.
Sich die Sprache geben: Literaten sind immer auch politisch Enttäuschte. Denn was ist Literatur, wenn nicht der Zeile um Zeile fortgesetzte Beweis, dass alles auch anders sein könnte? Du bist der in Ungarn geborenen, lange Ungarisch sprechenden und 2011 in Neuchâtel verstorbenen Agota Kristof nie begegnet, in ihren Texten aber erkennst du den Beweis, wie machtvoll und welterweiternd es ist, sprachliche Werkzeuge zur Hand zu nehmen.
Als du die erste Anhöhe, die ersten tausend Meter über Meer gelegenen Weiden erreichst, verstehst du, weswegen das berühmte, in allen Bars in schlanken Bouteillen auf Kundschaft wartende Suze hier seine Wurzeln hat: Selten haben sich dir so viele so stolz sich aus dem Boden stemmende gelbe Enziane gezeigt, welche offenbar die Schlüsselrolle tragende Zutat dieses Getränkes bilden, und würde dir jemand erzählen, die robusten grossen Blätter seien von Schriftstellern einst als Notizbuch verwendet worden, du würdest es glauben.
Envers de Convers, betitelt die Landeskarte den nächsten Rücken; du versuchst erst gar nicht, das zu übersetzen. Es ist wie bei Kristof: Sind die Worte auch klar und deutlich, stehen sie dennoch im Dämmerlicht eines Rätsels: Dans ma tête, un chemin caillouteux mène à l’oiseau mort. In meinem Kopf führt ein Schotterweg zu dem toten Vogel.
Ein kleiner Pulk von Langstreckenläufern nähert sich dir, eine buntgekleidete Sportgruppe, die, ihren rhythmischen Atem vor sich herschiebend, pferdegleich an dir vorbeitrabt.
In La Grand’ Combe, der folgenden, sich einer unscheinbaren Klus anschmiegenden Talschaft, wohnen derzeit vor allem Grillen. Auf der Ladefläche eines alten landwirtschaftlichen Anhängers, dessen Holz die schönsten Verwitterungen zeigt und stellenweise von Pflanzen durchwachsen ist, legst du dich in die nur noch eine Handbreit über dem Horizont stehende Sonne. Das Leittier einer nahen Kuhherde blickt argwöhnisch zu dir herüber, der ganze Rest der versammelten Fellmannschaft steht in einer der Bewegungslosigkeit entlangschrammenden Ruhe um die Tränke.
In einem staubigen Geländewagen, den Ellbogen im Fensterrahmen, kommt der Landwirt vom Wald her in die Weide gefahren. Während er wie nebenbei die Herde kontrolliert, ohne aus dem Fahrzeug zu steigen, kippt er, um sehen zu können, was du auf seinem Anhänger treibst, fast aus dem Sitz. Es bleibt bei diesen Blicken; was wir einander vielleicht zu sagen hätten, fällt polternd in den Sprach- und Vorurteilsgraben.
Also liege ich stumm und bäuchlings auf dem Anhänger und lese im alten Holz wie in einem Buch. Französisch ist die Sehnsucht. Französisch ist der Charme. Das Unerreichbare. Der Ausweg. Der Kuss. Französisch ist der Gesetzesbruch. Deutsch ist die Strafe.
Die Romands nennen den Blumenkohl Chou-fleur, machen ihn zum Souffleur – und schämen solltest du dich, die Westschweiz derart zu idealisieren.
Beobachtet, neugierig, von alterslosen, übers Feld hüpfenden Krähen, steigst du hoch zu einer beschaulichen Ebene, die sich Le Gurnigel nennt. Holzarbeiter haben dem Boden üble Schürfwunden zugefügt, die lange nicht vernarben werden.
Im Aufstieg zum Mont d’Amin kommt dir ein Läufer entgegen, in erstaunlich hohem Tempo, mit rotem Kopf. Er kommt näher und wird zu einem Gesicht, das du schon einmal gesehen hast. Wenig später kommt noch einer. Und noch einer. Du kennst sie bereits; aus der locker joggend miteinander sprechenden Gruppe sind rotköpfige Einzelkämpfer geworden, die, trockene Spucke im Mundwinkel, kaum noch einen Blick, geschweige denn ein Wort haben. Gerne würdest du ihnen ein, zwei Seiten aus Agotas Roman mitgeben.
Als du den unscheinbaren, fast baumlosen Rücken des Mont d’Amin erreichst, schickt sich die Sonne an, hinter den Wäldern La Chaux-de-Fonds kolossal zu ertrinken. Auf der Suche nach einem Liegeplatz findest du eine hübsche Föhre. Dass sie tot ist, nicht mehr steht, dass sie mit gebrochenen Armen neben ihren Wurzeln am Boden liegt, fügt sich perfekt zur Lektüre der spröden, melancholischen Prosa Kristofs.
Die wahre Poesie des Ortes zeigt sich dir, als du dich hinlegst: Der auf seine Äste gestürzte Baum schwebt zwanzig Zentimeter über dem Boden; er lässt, zwischen windbewegten Gräsern und seinem Stamm, ein Fenster offen, durch das du blicken kannst, sowohl auf die Windräder des Mont Soleil wie auch zu den ersten in der Dämmerung aufleuchtenden Lichtern des Uhrenstädtchens.
Ein hochkarätiges, lang anhaltendes Abendrot lässt sich mählich ablösen von den hochpräzis pulsierenden Blinklichtern der Windräder, ein über lange, in weiter Ferne liegende Kilometer sich hinziehendes, absolut synchrones Pochen, zu dem hin du auch mitten in der Nacht, als du dich für ein Mondscheinpinkeln aus dem Schlafsack schälst, hinäugst; als habe die Natur die Warnblinker eingeschaltet.
Anderntags steigst du hinab in das abrutschgefährdet an der Flanke des Mont d’Amin liegende Fontainemelon. In diesem Dorf hat Agota gearbeitet, hier hat sie Uhrenteile gestanzt, und du bildest dir ein, die Bäckerin, die dir mitten in deiner grossen Frühstückslosigkeit die weltbeste Tasse Kaffee serviert, könne an den an dir klebenden Moosen oder Föhrennadeln ablesen, dass du die Nacht draussen verbracht hast. Müsse dir ansehen, dass du mehr in der Lektüre eines Romans stehst als in deinen Schuhen.
Die Bushaltestelle gleich unterhalb der lokalen Uhrenfabrik heisst Sous l’usine, und während du am Rumpf dieses U-Bootes wartest, auf jenen Quadratmetern wohl, auf denen Kristof jeweils nach Arbeitsschluss gewartet haben mag, öffnet sich im gegenüberliegenden Fabrikgebäude eine Schiebetür. Chromstahlglänzende Behältnisse kommen zum Vorschein, Drahtrollen auch und säuberlich verlegte Kabel. Vor allem aber ein Brummen, Rattern und Zischen, derart rhythmisch und unterbruchsfrei, dass dir scheinen will, in jenem Teil der Uhrenfabrik werde die Zeit selbst hergestellt, werde abgefüllt dort in die allersaubersten Schachteln und von stressgeplagten Spezialisten hineinmontiert in jene Armbanduhren, die dann, getragen in den unter- und überschiedlichsten Ländern, weltweit mit dieser schweizerischen Zeit betrieben werden. Sich die Zeit nehmen, sich die Sprache geben, se donner la mort, se donner le mot.
Über die Fabrik hinweg blickst du zum Lac de Neuchâtel, zu dieser unwirklich anmutenden Versammlung silberglänzenden Wassers, und sollte dir später, durch die Strassen Neuchâtels spazierend, tatsächlich das eine oder andere Büschel Moos an der Hose kleben, sollte deswegen jemand schief blicken, wirst du schlicht mit Agota sagen: J’avais dormi une nuit dans la forêt, et voilà tout.