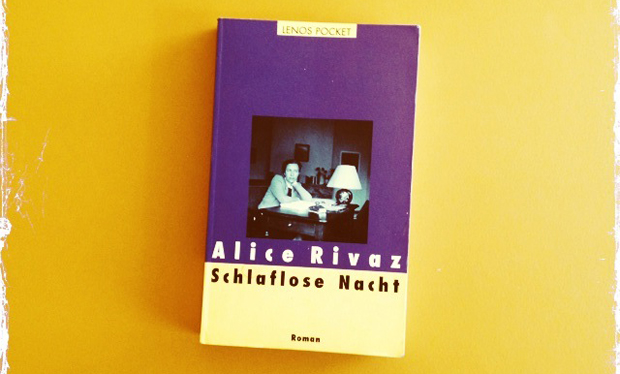Wo das Buch zur Randnotiz wird
Von der Studierstube auf den Rummelplatz: Selbst renommierte Verlagshäuser versenken Literatur immer häufiger zwischen Banalitäten und Hochglanzfotos. Kritik der zeitgenössischen Verlagsvorschau.

Wer sich über den Zustand der deutschen und internationalen Literaturkritik informieren möchte, sollte nicht in Feuilletonseiten, sondern in Verlagskatalogen blättern: in ihnen begegnet man der Quintessenz an kritischem Geist und Formulierungskunst, die man heute darin erwarten kann. «Dieses Buch nimmt es mit dem ganzen Leben auf.» Oder: «Eine tief bewegende Parabel.» Oder: «Ein Roman wie ein wunderbarer, schwindelerregender Spiralnebel.» Oder: «Ein Klassiker, der an seiner Heutigkeit nichts eingebüsst hat.» Oder: «Sprachgewandt, spannend und elegant.» Solch überbordender Banalität entgeht niemand, ob Debütant oder längst arrivierter Schriftsteller. Dem «Spitzentitel», nämlich einem neuen Roman Martin Walsers, widmete Rowohlt sechs Seiten, die ersten beiden beherrscht durch ein stattliches Halbfigurenporträt und untermalt von Kritikerzitaten, die von «unvergleichlicher Erzählkunst» schwärmen oder dass uns «kein anderer deutscher Schriftsteller so zuverlässig in Wallung» versetzt wie dieser Walser mit seinem Blick in die «Abgründe der menschlichen Verhältnisse».
Zweimal im Jahr stapeln sich die neuen Verlagskataloge in Buchhandlungen, Redaktionen und auf den Schreibtischen der Rezensenten. Es sind in der Regel grossformatige DIN-A4-Hefte, oft hundert und mehr Seiten umfangreich, nicht selten auf Glanzpapier vierfarbig gedruckt, broschiert, manchmal (wie bei Steidl) sogar mit Fadenheftung und mit hart kartoniertem Umschlag. Die Aufmachung ist auch hier schon wichtige Botschaft: das sind alles Edelprodukte, wie man sie aus anderen Geschäftszweigen kennt, aus den Hochglanz-Fotomagazinen von Mercedes oder BMW zum Beispiel. Adressaten sind die Buchhändler, die danach ihr Sortiment planen und die Besuche der Verlagsvertreter vorbereiten. Zeitungsredakteure richten danach ihr Rezensionsprogramm, Kritiker ihre Besprechungswünsche. Haben sie ihren Zweck erfüllt, landen sie im Papierkorb.
So war das jedenfalls über Jahrzehnte. Niemand hob sie auf, sammelte oder archivierte sie gar systematisch, auch nicht die Verlage selber. Das hat sich zum Glück geändert. Es gibt Bibliotheken, die ihre Sammeltätigkeit auf dieses kurzlebige, scheinbar bloss handelsorientierte Produkt des Buchmarkts ausgedehnt haben, in Marbach befindet sich eine der grössten Sammlungen, freilich nur ziemlich spärlich bestückt für die 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dabei geben diese Kataloge, die über Vermittlung von Buchhandel und Literaturbetrieb zuletzt auf den Endverbraucher – den Leser – zielen, einen anschaulichen Begriff von dessen Lesevorlieben. Sie spiegeln seine Wünsche und Abneigungen, seine Lektüregewohnheiten und sein Selbstverständnis, zuletzt auch die ihm geläufige Gesprächsebene über das Buch.
Von der Studierstube in den Medienrummel
Darüber hinaus die historischen Veränderungen in der Literatur, ihrer sozialen Bedeutung, der Rolle der Autoren, der Verlagsprofile, zuletzt der Kultur einer ganzen Gesellschaft: Die Autorin einer «Weltgeschichte der deutschen Literatur» (in 450 Seiten!) «will zeigen, wie Bücher wandern», und zwar «mit zahlreichen Illustrationen». Schliesslich gehörten «Literatur und Globalisierung» zusammen. Auch von den Sehgewohnheiten des Publikums erfahren wir eine Menge. Wer die Kataloge der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts mit den heutigen vergleicht, dem springen die Unterschiede sofort ins Auge: Man fühlt sich aus der Lese- und Studierstube ins lärmende Leben des Medienjahrmarkts versetzt.
Walter Benjamin notierte während der Arbeit am Katalog einer Lichtenbergbibliothek, «dass Buchtitel wichtiger sind als Bücher», doch weitete er sein Interesse bereits auf Aussehen, Zustand, Druckgestalt der Bücher aus, interessierte sich dabei besonders für die Spuren des Gebrauchs, für die Randbemerkungen, Hervorhebungen, Kritzeleien, die aus dem Massenprodukt ein individuelles Werk mit seiner Geschichte machen. Auch war der Katalog, den er vorhatte, nicht zum Bücherhandel bestimmt. Seine Bemerkung lenkt uns aber auf einen letzten Aspekt dieses Werbemittels: auf seine literarisch-rhetorische Gestalt. Seit den Schiffskatalogen der «Ilias», den genealogischen Katalogen des Alten Testaments (die Thomas Mann im Josephsroman nachstellte), den Frauenkatalogen der griechischen Mythologie geniessen wir mit dem Katalog auch ein ästhetisches Vergnügen. Der griechische Ursprungsbegriff bezeichnete denn auch ein episches Verfahren, womit die Verlagskataloge gleichsam auf die Wiege der Literatur zurückführen. In ihnen wird gezählt, was der Fall ist und von der Erinnerung aufbewahrt wird. Fülle und Vielfalt erfreuen darin wie ein reichgedeckter, doch wohlgeordneter Tisch oder wie die Ländereien, die Seen und Wälder und das ganze Gesinde des Grafen von Caracas im Märchen vom gestiefelten Kater die Glaubwürdigkeit seiner Erzählung garantieren.
Heute müsste man Benjamins Feststellung allerdings entscheidend erweitern. Nicht Buchtitel allein, sondern vor allem die Bilder sind wichtiger als die Bücher in den Verlagskatalogen. Bis in die 1960er Jahre herrschte die Schrift, die Bücher wurden beschrieben, ihr Inhalt nacherzählt; Bilder spielten eine untergeordnete Rolle, meist in Form kleinformatiger Porträtfotos, die an Passbilder erinnerten, gelegentlich, wie in frühen Rowohlt-Katalogen, mit Schwarz-Weiss-Zeichnungen eines Buchillustrators geschmückt. Dann treten die Titelbilder des «Schutzumschlags» hinzu, die typographische Vielfalt wird etwas grösser (Fett-, Kursivdruck, Grossbuchstaben, auch schon einmal Wechsel der Schrifttype). Im Laufe der 60er Jahre nimmt dieser Trend zu, leitet hin auf das Primat des Optischen in seiner gegenwärtigen Form, ersichtlich am Muster der Konsumwerbung orientiert. Auch der Supermarkt der Literatur sprengt inzwischen alle überlieferten Massstäbe.
Ständig Neues, schnell veraltet
Nimmt man ohne Rücksicht auf ihre Selbständigkeit (zur Verlagsgruppe Random House, früher Bertelsmann, gehören insgesamt 44 Verlage wie DVA, Heyne, Luchterhand, Siedler usw.) die Zahl der Verlage mit eigenem Programm, so hat sie sich seit den 1950er Jahren kaum geändert, dafür ist im gleichen Zeitraum die jährliche Titelproduktion auf das Sechsfache von etwa 16 000 auf 96 000 Titel gestiegen. Solche Zahlen können nur Annäherungen sein, sie markieren aber das Grundproblem aller Massenware: wie nämlich in der nicht mehr überschaubaren Menge noch Aufmerksamkeit für den Einzeltitel gewinnen, zumal das Lesepublikum im Gegenzug gewiss kleiner geworden ist? Die Auswege der Verlage aus diesem Dilemma: die ständige Produktion von Neuem, die nur durch schnelles Veralten und die dauernde Wiederkehr von Nochniedagewesenem erreicht werden soll sowie durch die optische Inszenierung des Buches als Spektakel.
Die Folgen wiegen schwer. Die Ordnung des Nacheinanders, der Entstehung und Entwicklung, dem Katalog einst wesentlich, löst sich auf. Die Bücher haben nichts mehr miteinander zu tun, weshalb in ein und demselben Katalog von grössten Erzählern und bedeutendsten Romanen die Rede sein kann, ohne dass sie sich ins Gehege kämen. Zerstreuung und Zusammenhanglosigkeit erschweren aber den Benutzern die Orientierung: wenn alles einzigartig ist, ragt nichts mehr hervor. Der Nachteil soll ausgeglichen werden, indem die optischen Reize in den Vordergrund treten. S. Fischer stellt einen Roman auf einer Doppelseite vor, worin mehr als ein halbes Dutzend Schrifttypen, mehrere Präsentationsweisen (abgerissene Zettel, Aufkleber, Unterlagen), Titelbilder, Autorenfoto zu einem schiefen Potpourri kombiniert sind, optische Anspielungen auf einen Titelbestandteil («Verzauberung»), die den spontanen Zugriff provozieren sollen. Die Form des Spektakels, mal Skandal, mal Weltende, mal «Wetten, dass…», hat sämtliche Elemente der Kataloge ergriffen, die Bilder, die Sprache, die typographische Machart, das gesamte Design. Daher die frappierende Ähnlichkeit der Broschüren: wer eine kennt, kennt alle, auch wenn es zwischen Suhrkamps Kriminalromanbibliothek und Blanvalet oder Heyne noch einige stilistische Unterschiede gibt.
In allen aber beherrschen farbige Autorenporträts die Szene, erstrecken sie sich gelegentlich über zwei und mehr Seiten hinweg aus verschiedenen Perspektiven. Wenn schon Qualitätsmassstäbe im massenhaft Ausserordentlichen untergehen («anspruchsvoll und bewegend», «ungeheuer persönlich», «ergreifend», «besonderer, vielschichtiger Roman», «wunderbare Prosa», «umwerfend gut geschrieben»: alles auf einer Seite über ein Buch), muss der Autor es richten. Er wenigstens ist unverwechselbar, einmalig. «Millionen von Lesern haben auf ihn gewartet», er fungiert als Führer oder Guru oder Zauberin: «Marion Poschmann versetzt ihre Leser in einen Schwebezustand, in dem wir als glückliche Leuchtpapierkugeln den Orbit ihres Ruhms bilden.» Ist das noch zu übertreffen? Ja doch, im selben Katalog von einer «Sprachverführerin», «die mit uns durch Hölle und Himmel spaziert». Die Porträtfotos daneben sind Starfotos nachgestellt, wie man sie aus der Illustriertenpresse kennt. Smarte Männer mit Dreitagebart, attraktive Frauen im üppigen Haarrahmen, das fotografische Schriftstellerporträt unterscheidet sich nur selten noch von der gängigen Werbeware. Scheint durch die eitle, oberflächliche Maske noch etwas von der inneren, individuellen Realität? Zeugt das Bild von einer überlegten Auseinandersetzung des Fotografen mit der anvisierten Person, von kritischer Begleitung oder von den Irritationen Leben und Gesellschaft gegenüber, die die kurzen biographischen Notizen oft andeuten: also von «Suche nach neuen Erfahrungen», von einem «psychologischen Drama», von «Desillusionierung und Entblössung»? Nein, überall nur Oberfläche, Attitüde, auch von Humor, Ironie, gar tieferer Bedeutung keine Spur. Glaubt man den Katalogen, so ist das Schriftstellerporträt auf dem Stand der Modefotografie des späten 20. Jahrhunderts stehengeblieben (zum Glück dementiert dann eine Künstlerin wie Isolde Ohlbaum in ihren Porträtbänden den Augenschein der Verlagspräsentationen). Es erfüllt also in den meisten Fällen das Versprechen nicht, dem es seine exorbitante Rolle in der Werbung verdankt, nämlich das Produkt, Roman oder Essay oder Gedichtsammlung, aus der Masse herauszuheben. Die Enttäuschung kennt jeder, der dem gefeierten Autor bei einer Dichterlesung in persona begegnet: hat der dann allerdings etwas zu sagen, tritt er aus der Musterhülle des Katalogs hervor und beglaubigt im besten Falle die Sonderstellung, die jener leerformelhaft behauptete.
Lyrische Sprachohnmacht
Nun kann man die Frage stellen, ob Verlags-, also Werbekataloge dazu da sind, ihre Gegenstände differenziert und dem Selbstverständnis der Schriftsteller angemessen darzustellen. Schliesslich lebt die Lobrede seit den Anfängen von Übertreibung. Das Reihungsprinzip des Katalogs treibt diese Technik freilich ins Absurde. Nur wer zu vergessen bereit ist, schon auf den Seiten zuvor immer schon dem oder der Grössten begegnet zu sein, dem stösst die ständige Wiederholung nicht jedes Mal wieder auf. Indem der Katalog allen Platzhaltern auf irgendeine Weise Meisterschaft und Genialität nachrühmt, macht er die Zeichen beliebig, konterkariert ihre einstige Bedeutung. Man könnte diese abgestandenen Redewendungen wie einst Flaubert in einem Phrasen-Dictionnaire, den er seiner Zeitungslektüre verdankte, zusammenstellen und danach beliebige Werbetexte generieren: von «aussergewöhnlicher Erzählkunst» bis zum «Zenit der Erzählkunst», vom «Beweis einer grossen Erzählstimme» bis zu «vielgerühmter lyrischer Sprachmacht», vom «virtuosen Kunstwerk» bis zur «wunderschönen magischen Prosa». Monströse Formeln stilistischer Stupidität und doch funktionieren sie, den Lichtreklamezügen am Piccadilly ähnlich, die mit immer gleichen Reizen überschütten. Es sind oft namhafte Kritiker, die hier mit ihren abgegriffenen Redensarten und geistigen Kurzschlüssen zitiert werden. Das Markenzeichen der Zeitung oder Zeitschrift, für die sie schreiben, ist dann oft wichtiger als ihr Name, der gar nicht mehr erscheint.
Zu reden beginnen die Verlagskataloge nicht durch das, was sie sagen, sondern wie sie – nichts sagen. Wiederholung, Abkürzung, Auflösung der Satz- und Gedankenordnung, Ersatz des begründeten Urteils durch die Evidenz des schönen Bildes, Beziehungslosigkeit und Fragmentierung; das alles sind Strategien des Vergessens. So endet die Kataloggeschichte in einer doppelten Ironie. Aus dem Epos und der mythologischen Erzählung entstanden, wo er als Gefäss und Instrument der Erinnerung diente, hat ihm ausgerechnet der moderne Verlagskatalog Zeit und Gedächtnis ausgetrieben: Und das noch dazu im Namen des Buches, des auch im digitalen Zeitalter wichtigsten, weil haltbarsten Mittels der Überlieferung und des geschichtlichen Wissens. Gibt es einen einzigen deutschen Verlag, der nicht jederzeit und lautstark die besondere Qualität der Ware Buch als des wichtigsten Trägers der intellektuellen Kommunikation und kulturellen Entwicklung betonte? Zum Beispiel auf der Frankfurter oder Leipziger Buchmesse, oder immer und überall, um die Buchpreisbindung zu verteidigen? Selten finden diese Argumente sich in der alltäglichen Verlagspraxis wieder. Die gibt sich mehr oder weniger bewusstlos oder fatalistisch den Regeln der Massenkommunikation, den Gesetzen des Spektakels hin und bedroht damit schliesslich die eigene Geschäftsgrundlage. Solche Feststellungen haben nichts mit Nostalgie zu tun, es gibt kein Zurück zu den Katalogen der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Doch sind die enormen technischen Möglichkeiten, die Errungenschaften des modernen Designs und der Computertechnik wertneutral und haben das nach wie vor umfassende Potenzial, unser Gedächtnis zu erweitern oder aufzulösen, das kritische Denken zu befördern oder zu ersticken, historisches Bewusstsein zu entwurzeln oder in neue Zusammenhänge hineinwachsen zu lassen. Auf den Gebrauch kommt es an, und probiert wird ja auch hier und da: bei Reclam und Dietz jeweils der eigenen Geschichte folgend, aber vor allem in den Verlagskatalogen kleiner Häuser, also bei Berenberg oder Matthes & Seitz oder Klöpfer & Meyer. Denn Buchhandelskataloge können der ideale Ort sein für eine neue Probe aufs eigene andere Exempel, nämlich des Buches.