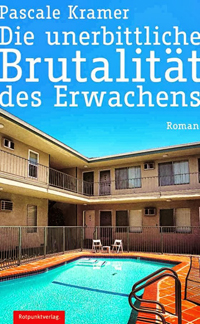Zorn auf Zuruf
Als «Gewissen der Nation» haben Literaturschaffende abgedankt – doch in den Spott mischt sich gelegentlich Sehnsucht nach dem «Gegendiskurs». Kann da noch was kommen? Über einige Schwierigkeiten engagierter Literatur im spätmodernen Betrieb.
«Wer kann da heute noch sagen, dass sein Zorn wirklich sein Zorn ist, wo ihm so viele Leute dreinreden und es besser verstehen als er?!»
Robert Musil, «Der Mann ohne Eigenschaften»
Am 13. Oktober möchte Jonas Lüscher fünf Millionen Europäerinnen und Europäer auf die Strassen bringen, um «gegen Nationalismus und für ein geeintes Europa» zu demonstrieren. Sein Team charakterisiert der aktuelle Träger des Schweizer Buchpreises als «Mitglieder der Zivilgesellschaft, denen das Nachdenken und Schreiben nicht mehr genügt und die ins Handeln kommen wollen». An seinen offenkundigen Widersprüchen – mit Facebook für die «Freiheit», mit der eigenen Prominenz gegen den «Ruf nach starken Männern», mit Formatvorlagen für die Vielfalt, mit Massen für die einzelnen – dürfte das ehrenwerte Projekt dabei eher wachsen denn scheitern: Wiederholt hat sich Lüscher zum akademischen Common Sense bekannt, im Aushalten von Aporien eine aufgeklärte Haltung zu sehen.
Ob die sarkastisch überzeichnete Kritik neoliberaler Denkweisen in Lüschers ersten beiden Büchern diesem Anspruch genügt, wird das weitere Werk zeigen: Womöglich ist es gerade die humorige Vereinnahmung der Leserinnen und Leser durch Lüschers Erzähler, die das Publikum zum Widerspruch und Weiterdenken anregen soll. Aus der risikoarmen Hängematte sanften Spotts über barbarische Banker, angezählte Akademiker und kalifornische Technikträumer würde dann vielleicht in der Tat jenes kritische Katapult, das ein breites Publikum bereits jetzt in Lüschers Büchern zu sehen vermag.
Nicht weiter im Text?
Aus dieser Bereitschaft spricht das ebenso tiefe wie totgesagte Bedürfnis nach einer kritischen Gegenwartsbegleitung durch Literatur. Dieser Wunsch hat eine Geschichte, die unterdessen auch schon zweieinhalb Jahrhunderte währt: Aus dem Drang, neue Zeiten auf eine neue, angemessene Weise zu erzählen, gingen der Roman und die publizistische Prosa um 1800 als Sieger hervor. Den teils ersehnten, teils bedauerten Verlust alter Sicherheiten durch die Emphase des Neuen, Vorläufigen und vor allem Offenen zu kompensieren, gehört seitdem zu den grossen Verdiensten der Prosa.
Aus der ironischen Skepsis jedoch, die den Wunsch nach «dem Wenderoman» oder «dem Roman zur Finanzkrise» nicht erst seit gestern begleitet, spricht ein ebenso tiefes Unbehagen: Kann es der Roman als Form nochmals mit der «Welt» aufnehmen? Konnte er es denn je? Schaffen es die Schriftsteller, ihre «freie», nicht selten auch «vogelfreie» Position in Zeiten umfassender wirtschaftlicher und sozialer Kontrolle zu behaupten? Oder spielen sie bloss mit? Und dürfte man ihnen das verübeln? Kommt es auf die einzelnen Schreibenden überhaupt noch an? Haben sich die früheren Funktionen der Literatur nicht einfach auf mehrere Medien verteilt? Finden die neuen Epen nicht ohnehin auf Netflix statt? Wohnt dem Wunsch nach starker Autorschaft, nach «auctoritas», nicht ein überholtes paternalistisches Wunschdenken inne? War die Literatur nicht seit jeher eine Parasitin der Krise? Und die meisten Schreibenden ihren eigenen Worten nur selten gewachsen?
Grosse Fragen. Zum Davonlaufen eher geeignet als zum Durcharbeiten. Jonas Lüscher läuft nicht weg, sondern tritt einen Schritt zur Seite. Alle Türen weiterhin offen: dem Schreiben von «politischen Romanen» und «philosophischen Papieren» hat er keineswegs entsagt, wie der vielfach als «neuer Max Frisch» Gefeierte im Interview mit der «WOZ» versichert. Aber er hat eine Pause eingelegt, geht eine Weile nicht weiter im Text. Was sagt das über die Schwierig- und Möglichkeiten engagierter Literatur in der digitalen Spätmoderne?
Von der Rolle
Welches Unbehagen dokumentiert nun Jonas Lüschers Wunsch, aus seiner gerade erst gefestigten Diskursposition als kritischer Autor in der Tradition Max Frischs zu «konkreterem Handeln» zu kommen? Die Haltung – oder auch: Pose – des engagierten Schriftstellers steht bekanntlich schon seit Adorno unter Verdacht, mit dem allzu gut Gemeinten nicht nur die Kunst zu verraten, sondern erst noch das kritisierte System durch das Vorgaukeln seiner Ansprechbarkeit zu stützen. Während also jede feste Position sich schlecht mit dem Eigensinn ästhetischer Formen verträgt und diese als «Message» im schlimmsten Fall überflüssig macht, droht das verlässlich in Sonntagsreden eingeforderte «Mitreden» der Kunstschaffenden seine eigene Wirkungslosigkeit zu übertönen und eine Art Scheindiskurs auf die Bühne zu bringen: Zorn auf Zuruf.
«Was also tun, wenn die kritische Funktion der Literatur ebenso lautstark eingefordert wie zischelnd verachtet wird?»
Dieser Verdacht, dass die kritische Rolle der Schreibenden diesseits aller «Standpunkte» zuvorderst eine Rolle in einem durchaus fremdbestimmten Spiel ist, erschwert die wirkungsvolle Intervention in Zeiten spätmoderner Hyperfiktionalität ungemein. Wo alles eh nur eine Geschichte ist, ein Spiel, eine Simulation, eine Performance, sind die professionellen Spielerinnen und Erzähler zugleich besonders verdächtig und antiquiert: Manipulieren sie das Spiel besonders geschickt, oder hängen sie selbst hilflos im Netz der von einem Standpunkt aus ohnehin unkontrollierbar gewordenen Narrative?
In diesem Umfeld stehen, um in der Schweiz zu bleiben, die wenigen überhaupt politisch äusserungswilligen Schreibenden in der mindestens dreifachen Gefahr, als zynisch kalkulierende Aufmerksamkeitsökonomen, als naiv und weltfremd vor sich hin Fabulierende oder aber als Verräter der Kunst auf die Plätze verwiesen zu werden. Lukas Bärfuss, Melinda Nadj Abonji, Felix Philipp Ingold oder auch Dorothee Elmiger dürften davon ein Lied singen können. So musste sich beispielsweise Bärfuss vorwerfen lassen, in seinem neuen Roman habe wieder einmal der Essayist den Erzähler verdrängt, während ein Bericht über Nadj Abonjis politisches Engagement nicht ohne die Spitze auskam, Flugblätter und Petitionen seien das eine, ein neuer Roman aber das – wohl irgendwie geschuldete – andere.
Was noch ginge
Was also tun, wenn die kritische Funktion der Literatur ebenso lautstark eingefordert wie zischelnd verachtet wird? Wenn Aufhören, Privatisieren, Umsatteln keine Option ist?
Für die Autorinnen und Autoren hatte Adorno den Rat, es mit Avantgarde zu versuchen. Um gar nicht erst den Eindruck täuschender Zugänglichkeit zu erwecken. Dorothee Elmiger ist diesen Weg in ihren ersten beiden Büchern mit einigem Erfolg gegangen, ihr gegenwärtiges Schweigen tönt interessanter als viele Einlassungen ihrer Kolleginnen und Kollegen. Dass sich Jonas Lüschers Aufruf liest wie die Reden einiger diskursmüder Figuren aus Elmigers «Schlafgängern» von 2014, passt da durchaus ins Bild. Nur: Elmigers Romane sind ein paar Jahre alt, Adornos Avantgarden längst historisch, was ginge noch?
Ein bisschen bewusster manövrieren bei der Wahl der Kanäle? Nicht auf die Podien gehen, auf denen man ohnehin erwartet wird? No more preaching to the choir? Die eigenen Texte umgekehrt denen aufdrängen, die einen zur Karikatur heruntergeschrieben haben? Twitter mit beredtem Schweigen beehren? Von Uwe Johnson, Brigitte Reimann oder Marcel Beyer ein paar Lektionen in ästhetisch produktiver Schroffheit lernen? Unbedingt − und unbedingt machbar.
Die eigene Stellung durchleuchten, ehe man Stellung bezieht? Wenigstens dann, wenn kurz Feuerpause herrscht? Nicht immer möglich, fast immer nötig. Woher kommt mein Sprechen, wohin geht es? Wer zahlt, in bar und mit symbolischem Kapital, auf wessen Kosten die Bühne? Wer würde noch auftreten mit dem eigenen Lohnzettel für den Abend in der Hand, welcher Art wäre da die Scham und bei wem? Lässt sich aus dieser Scham etwas machen? Vom deutschen Autor und Publizisten Stefan Mesch lässt sich da einiges lernen.
Namen nennen. Oder wenigstens die Dinge beim Namen. Nicht leicht in der Schweiz, wo sich die Termine im Kulturkalender ständig kreuzen. Trotzdem Feigheit nicht mit Solidarität verwechseln.
Das Gute, das noch gut zu Machende sehen? Unbedingt. Auf dem eigenen Acker. Nie wurde so viel geschrieben. Gelesen, gefördert, gepusht. «Krise war immer», ätzte schon Gottfried Benn, der sein Geld als Hautarzt mit jeweils verschatteter Praxis verdiente. Die meisten Stipendien führen heute an hellere Orte. Auch auf dem grösseren Acker ist längst nicht die gesamte Ernte verhagelt. Viele Haltungen, die lange nur im poetischen Probekeller durchgingen, stehen zumindest in Teilen des Westens auch bei Tageslicht zur Verfügung: in Zungen reden, in den Als-ob-Modus schalten, Produzieren, Verfremden, Nachbauen, Ironisieren, Filtern, Tagträumen, you name it.
Bücher schreiben. Das ist eigentlich Statement genug. Bekenntnis zur Dauer. Zum Warten, zur Lauer, zum Durchkämpfen. Zum Nicht-dreinreden-Lassen. Zur eigenen Stimme. Den anderen Stimmen darin. Den Rest erledigen die anderen. Und umgekehrt. Schwacher Trost, aber ohne ein paar Umkehrungen wird es nicht gehen. Vielleicht haben die Besorgten ja recht und die Literatur hatte schon einmal mehr zu verlieren als heute. Dann gibt es allerdings wenig Grund, nicht auf Risiko zu spielen.