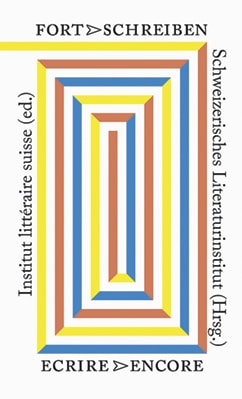Das Wort des anderen
Wie ich schreibe.

Der Schriftsteller spricht. In Prosa oder in Versen. Er spricht mich persönlich in einer besonderen Sprache an, die er mit mir teilt. Darin liegt die Kraft der Literatur: Sie wendet sich an das Individuum und spricht zu jedem von uns auf andere Art. Das Wort ist nicht nur so dahingesagt: Es ist der Atem eines lebendigen Wesens, der uns erfrischt, uns tröstet, uns bewegt, uns anregt, uns mitreisst. Um uns mitreissen, zum Lachen bringen, bewegen, trösten und erfrischen zu können, muss das Wort des Schriftstellers lebendig sein und mit seiner direkten oder indirekten Erfahrung zu tun haben. Erfahrung kann auch einfach ein Mann sein, der auf der Strasse vorübergeht, ein im Zugfenster gespiegeltes Bild, eine geträumte Liebe, eine im Gehirn hängengebliebene Silbe: etwas, das uns Fragen stellt und die Hülle der Einsamkeit durchbricht. Und genau so war meine erste literarische Erfahrung: ein Mann, der unten vor dem Haus auf der Strasse vorbeiging. Ich sah ihn am Fenster meines Zimmers, in der Peripherie von Chiasso. Er war nicht weit weg, der Mann, aber auch nicht sehr nah. Im richtigen Abstand. Allein ging er auf der Strasse vorüber, und ich betrachtete ihn vom Fenster aus. Ich kannte ihn nicht. Er kam von der Arbeit, über der Schulter das, was man früher Matchsack nannte. Einer von vielen. Ein Maurer, glaube ich. Und während ich ihn betrachtete, begriff ich, dass Schreiben bedeutete, aus mir herauszugehen, um ein wenig jener Mann zu werden. Ein anderer zu werden, um ich selbst zu sein. Doch heute frage ich mich: Ist es möglich, der Andere zu sein? Bleibt man nicht immer auf halber Strecke in einem terrain vague zwischen Vertrautheit und Fremdheit?
Damals begann das Wort mich anzuziehen, warum, weiss ich nicht. Vielleicht, weil ich wenig redete und gerne zuhörte. Ich hatte den Eindruck, die Worte der anderen seien interessanter als meine. Mein Grossvater, der weder lesen noch schreiben konnte, erzählte mir, dass er sich als junger Schmuggler auf dem Friedhof eines Grenzdorfs hinter einem Grabstein versteckt hatte, um der Finanzpolizei zu entgehen. Und mein Vater hatte in Kriegszeiten beim Nachbarn Kartoffeln gestohlen, um nicht hungern zu müssen. Diese Geschichten hätte ich nie selbst erleben können! Schreiben aber konnte ich sie, indem ich meinem Grossvater und meinem Vater zuhörte. Ich konnte das Wort mit ihnen teilen, auch nach ihrem Tod. Und nun, angesichts dieses unbekannten Maurers, der unter meinem Fenster vorbeiging, dachte ich: Er muss ein paar Worte für mich haben, für mein schwarzes Notizbuch.
Damals besass ich nämlich ein Notizbuch mit schwarzem Pappeinband, das mir ein Schulkamerad geschenkt hatte. Einen Taschenkalender, in dem die Namen der Wochentage auf Deutsch standen. In dieses seltsame Notizbuch begann ich Verse zu schreiben und dabei zu verstehen, dass Dichtung etwas mit Anderssein und Demut zu tun hat, was das Gegenteil von Hochmut ist. Mit Nähe und zugleich mit Ferne. Mit Vertrautem und mit Fremdem: Genau wie die auf Deutsch gedruckten Tage in dem schwarzen Taschenkalender anders wirkten, mussten auch die Worte der anderen in einem neuen Licht erscheinen, wenn ich sie in Zeichen verwandelte. Und als ich nach dem Tod meines Vaters aufs pädagogische Gymnasium kam, schrieb ich ins Aufsatzheft einen Satz, für den ich beinahe von der Schule geflogen wäre. Es war ein einfacher Satz, den ich den Knecht des Bauernhofs hatte sagen hören, wo ich mit meinen Freunden zum Spielen hinging: Das Wort des anderen war demnach eine Waffe, wenn es Verwirrung unter den Lehrern gestiftet hatte. Ein Abenteuer. Das genügte, um mich zu bewegen, Schriftsteller zu werden. Martin Eden, der Held von Jack London, ermutigte mich auf diesem Weg. Und durch den martin pescatore, den Eisvogel, den ich mit seinem grünblauen Gefieder im Flussbett nahe bei unserem Haus gesehen hatte, entdeckte ich die Schönheit. Mit diesen beiden «Martini» beschloss ich, auf die Suche nach Worten zu gehen.
Als ich etwa zwanzig Jahre alt war, genügte es mir nicht mehr, unschuldige Verse zu verfassen: Ich wollte gern eine Geschichte erzählen. Doch in der Luft lag viel Geraune, das mich einschüchterte. In Italien tobte die Neoavantgarde und erfüllte mich mit Zweifeln: Warum sollte auch ich die Uniform anziehen und die Literatur in ein Ratespiel verwandeln, wenn in den Männern und Frauen meiner Umgebung so viele verborgene Worte steckten? Meine Mutter erzählte mir von der Zeit, als sie in die Fabrik ging und Zigarren rollte, ihre Worte flossen im Helldunkel der Stube dahin. Dann begegnete ich Tonio, einem alten Steinmetz, der im Spanienkrieg gegen Franco gekämpft hatte: Bei ihm zu Hause in Arzo stellte ich das kleine Tonbandgerät auf den Tisch neben die Grappaflasche und liess mich verzaubern. Vielleicht war das mein Weg: von den Worten meinesgleichen auszugehen.
Auf dem Friedhof von Vacallo, meinem Ursprungsort, gab es einen alten Grabstein mit der oval gerahmten Fotografie eines Banditen aus dem 19. Jahrhundert, der im kollektiven Gedächtnis eine Spur hinterlassen hatte. Die Geschichte jenes Mannes zu erzählen bedeutete, eine Weile in dem Dorf zu leben, in dem ich nie gewohnt hatte, das aber von meinen Vorfahren sprach. Es bedeutete, ein nicht gelebtes Leben mit Worten aufzuwiegen. Doch meiner Mutter und Tonio hatte ich mit eigenen Ohren zuhören können, wie aber sollte ich in mir die Worte der verzweifelten Männer zum Klingen bringen, die Mitte des 19. Jahrhunderts eines Nachts die Hügel bei Mendrisio überquert hatten, um den Reichen ihren Weizen zu stehlen? Mehr oder weniger zufällig entdeckte ich diese Worte im Kantonsarchiv von Bellinzona. Sie waren in den Untersuchungsberichten enthalten: die Erklärungen, die Bauern und Ziegelbrenner, zumeist Analphabeten, vor dem Richter abgegeben hatten, der sie befragte. Mir war, als hörte ich sie. Noch immer bewahre ich die karierten Hefte mit meinen handschriftlichen Transkriptionen jener lebhaften Aussagen auf. Die Erzählungen, die ich nach zwei Gedichtbänden veröffentlichte, waren zum Teil mit dem Beitrag anderer entstanden. Selbst der Titel, «Terra matta», war ein volkstümlicher Ausdruck; genau wie auch jener, den ich als Schüler in mein Heft geschrieben hatte und den die Lehrer, zur Beratung in einem Raum mit Deckenfresko zusammengekommen, verurteilt hatten. Mein erstes narratives Buch war meine Rache für diese Verurteilung.
Vielleicht hatte ich also einen Weg gefunden, dem ich folgen konnte und der wenig begangen war: Ich bemühte mich, meine Stimme mit der Stimme der Menschen zu verflechten, die um mich waren, und herauskam ein kurzer Roman (ich gab ihm einen Eisenbahntitel, «Tutti discendono» – Alle aussteigen –, da meine kleine Stadt voller Zöllner und Eisenbahner war), und ich versuchte darin, meine persönliche Geschichte eingebettet in das Milieu zu erzählen, das mich hatte aufwachsen sehen. Als ich dann in meinem Stammbaum einen Schritt zurückging, fand ich einen Grossonkel, Bruder der Grossmutter väterlicherseits, der in der psychiatrischen Anstalt von Colengo an Melancholie gestorben war. Die Polizei führte ihn in ihrer Kartei als Anarchisten, und nach seiner Rückkehr aus Uruguay, wohin er ausgewandert war und wo man ihn ausgewiesen hatte, unternahm er einen Selbstmordversuch. Mir genügten drei Worte, um ihn wieder zum Leben zu erwecken, mit zittriger Schrift geschrieben von seiner Nichte, die ich in Maslianico besucht hatte: poru zio Tugnöo. Armer Onkel Tugnöo.
Muse meines dritten narrativen Buchs war eine unglückliche Frau. Ich hatte ihr Foto neben einem Artikel des Polizeiberichts in der Zeitung gesehen: Ein Hündchen im Arm, stand sie neben einem Wohnwagen. Ihre Geschichte machte mich neugierig, weil darin von einer unmöglichen Liebe und einer nicht verwirklichten Berufung die Rede war: Doch wie ihre Worte finden? Im Lauf meiner Recherchen hatte ich unverhofftes Glück: die Mutter von Tosca – so nannte ich mit einem erfundenen Namen die Protagonistin des Romans – vertraute mir das handgeschriebene Tagebuch ihrer Tochter an, und mit dessen Hilfe versuchte ich, die Geschichte zu erzählen, und liess sie am Ende mit einem Chor von Stimmen anderer über die Unglückliche ausklingen. Ich gab dem Roman den Titel «La Lirica», die Sängerin, wie die Leute die Frau ironisch nannten. Meine Begegnungen gingen demnach weiter, wie um etwas zu ersetzen, das in mir fehlte. Und vielleicht ist das die ethische Funktion der Literatur: Eine Leere zu füllen, einen Mangel auszugleichen, das eigene Leben intensiver zu leben, indem man sich in die Lage anderer versetzt.
Als nächstes entstanden dann die Erzählungen des Bandes «Fiori d’ombra», Schattenblüten, in denen ich unter anderem eine meiner Töchter und ein blindes Mädchen zu Wort kommen lasse. Und im folgenden Buch erfand ich dann mit einem Sprung zurück in der Zeit die Worte eines Protagonisten der portugiesischen Arbeiterbewegung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts: José Fontana, der sich 1872 das Leben nahm. Ich wählte die erste Person, und es war die Entdeckung seiner Stimme, die mich überzeugte, den Roman nach mehreren qualvollen Anläufen fertigzuschreiben. Ich wurde selbst ein wenig zu José. Der Einfühlungsprozess erlaubte mir, viele meiner Phantasien auf ihn zu projizieren und viele Träume nachzuträumen, die seine gewesen waren: allen voran jenen von einer Gesellschaft ohne Ungerechtigkeit. Entsprechend meiner Poetik benutzte ich seine eigenen Worte für den Titel meines Romans, «La prossima settimana, forse» – Nächste Woche, vielleicht: so pflegte José nämlich zu antworten, wenn er gefragt wurde, wann die Revolution ausbrechen werde.
Heute weiss ich, dass die Revolution vielleicht nur in uns möglich ist: Nur in der Vorstellung wird der Fuss Flügel. Und die Literatur verändert die Welt nicht, kann aber die Art verändern, wie man die Welt betrachtet. Sie kann uns innerlich verändern. Denn die Poesie, die Erzählung, der Roman sind ansteckende Übungen in Menschlichkeit. Meine Übung findet sowohl in Prosa als auch in Versen statt. Sogar den Titel für eine meiner Gedichtsammlungen, «Il colore della malva», habe ich einer Dorffrau gestohlen, die mir von ihrem kranken Bruder erzählte und sagte, sein Gesicht sei von der Farbe der Malve. Und noch ein Beispiel. In meiner letzten Sammlung gibt es ein Gedicht, das beginnt so: «Ich blicke mich um und sehe eine grosse Wüste.» Ein Zitat von Beckett? Nein, es ist der Satz eines pensionierten Eisenbahners, dem ich auf der Strasse begegnete. Auf Dialekt gesprochene Worte, die ich in gutes Italienisch übersetzt habe: Doch mein Gedicht mit dem Titel «Il Solitario», der Einzelgänger (einer der Monologe, in denen ich meinen Figuren das Wort überlasse), müsste nicht nur von mir gezeichnet sein, sondern auch von ihm, dem pensionierten Eisenbahner, dem ich den Anfang gestohlen habe. Und der Vers «È una fortuna passeggiare tra i castagni» – Es ist ein Glück, unter Kastanien zu gehen, der aus einem Jugendgedicht von mir stammt, müsste die Unterschrift der Frau tragen, die damals auf jenem Spaziergang bei mir war.
Im letzten Sommer traf ich einen Bekannten, der mir auswendig eines meiner Gedichte aufsagte: Das ist es, dachte ich, ich bekomme zurück, was ich mir ausgeliehen habe. Denn zu den Prinzipien meiner Poetik gehört es zu kommunizieren, das heisst, Gemeinsamkeit herzustellen. Deshalb versuche ich, das Wort des anderen aufzugreifen, es nicht sterben zu lassen. «Der wahre Dichter», sagt Tzvetan Todorov bezogen auf Marina Cvetaeva, «hört auf die Welt, nicht auf die Literaturexperten.» Doch das Wort des anderen ist auch das Wort des von mir verschiedenen Schriftstellers, der sich, wie ich, von der Literatur hat umgarnen lassen: Auch von dessen Wort ernähre ich mich.
Ein weiteres Prinzip ist das des Eisvogels, den ich als Junge im Flussbett neben unserem Haus gesehen habe: die Schönheit. Die Sprache der Literatur besitzt eine Schönheit, die eine unauslöschliche Spur in uns hinterlässt – und uns menschlicher macht.
Alberto Nessi wurde mit dem Grand Prix Literatur 2016 ausgezeichnet.