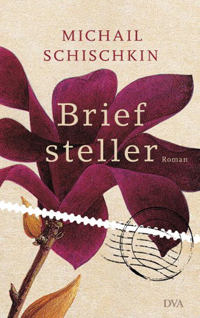Eher Autor als Zeichner
Der Künstler Frédéric Pajak arbeitet mit Bild und Text – gegen das Label
«Graphic Novelist» wehrt er sich aber. Ein kurzes Treffen mit einem,
der hier falsch ist.

Herr Pajak, Ihre Werke sind soeben im Rahmen der Solothurner Literaturtage als «Graphic Novels» präsentiert worden. Wer oder was inspiriert Sie?
Ich lese sehr viel. Eigentlich ziehe ich meine ganze Inspiration aus der Lektüre von Autoren, die ich spannend finde. Momentan vor allem Walter Benjamin. Zumindest das, was ich auf Französisch bekommen kann. Es gibt noch nicht alles in französischer Übersetzung, was ich sehr schade finde. Für meine aktuellsten Werke habe ich aber besonders viel von ihm gelesen und die gewonnenen Eindrücke dann in meinen Bildern umgesetzt, zum Beispiel seine Briefkorrespondenz mit anderen Autoren. Übrigens, eines vorweg: ich sehe mich nicht als Graphic Novelist. Nein, eigentlich sehe ich mich gar nicht so.
Nein? Dann sind Sie an dieser Ihrer Ausstellung also streng-genommen deplaciert?
Ja. Es ist nun einmal nicht so, dass ich meine Geschichten mit Bildern illustriere; ein Bild sagt etwas anderes als ein Text. Was ich nicht mit Texten sagen kann, drücke ich mit Bildern aus und umgekehrt. Ich sehe mich deshalb eher als Autor, nicht als Zeichner; meine Arbeit ist sehr textlastig und daher eher philosophisch.
Philosophisch – ein gutes Stichwort. Woher kommt Ihr Interesse an der Text-und-Bild-Auseinandersetzung mit der Philosophie?
Mein erster Herausgeber war die französische Universitätspresse – ein immenses Haus, das bis dato weder Zeichnungsbücher herausgab, noch Werke von Nichtstudierten veröffentlichte. Mich schon. Verstehen Sie, ich habe nie studiert, doch meine Arbeit handelte schon früh von Nietzsche, Apollinaire und Schopenhauer – das wurde akzeptiert, gedruckt. Ein Glücksfall, wenn man Interesse und Job vereinen kann.
Sie haben also weder eine zeichnerische noch eine literarische Ausbildung abgeschlossen?
Richtig. Das ist auch nicht nötig. Ich selber war nie viel in der Schule, ich wollte immer schreiben und Autor sein – dafür braucht es aber keine Ausbildung an einer Universität. Man muss sich nur bewusst sein: Es ist sehr viel Arbeit. Und das ist das Schwierige daran: man muss stets Durchhaltewillen zeigen. Man muss sich selber sehr gut kennen, um die Arbeitsweise zu finden, die einen am meisten herausfordert. Ich zum Beispiel bin eher expressionistisch veranlagt und sehr temperamentvoll. Also zwinge ich mich, so einfach wie möglich zu schreiben, meine Geschichten aufs Wesentliche herunterzubrechen. Ich finde, es ist viel schwieriger, so einfach wie möglich zu schreiben, als seine Geschichten mit vielen aussagekräftigen Worten auszuschmücken. Schlussendlich ist es für mich deshalb die Arbeitsweise, die mich als Autor am meisten wachsen lässt.
Viele Ihrer Kollegen setzen zum Teil wortgewaltige Romane zeichnerisch um. Reizt Sie das nicht?
Nein, ich arbeite nicht so. Meine Zeichnungen sind meine eigenen Geschichten. Aber, zugestanden, ich plane, von dieser Regel bald eine Ausnahme zu machen. Ich werde den Roman «Nadja» vom französischen Schriftsteller André Breton zeichnen. Mich fasziniert die Geschichte sehr: Der Erzähler des surrealistischen Romans, der gleichzeitig der Autor selbst ist, begegnet in Paris einer Frau, die ganz offensichtlich nicht in derselben Realität lebt wie er. Es entwickelt sich eine Liebe zu ihr, die in Nadjas entrückter Schönheit gründet. Ich werde der weiblichen Hauptfigur, eben dieser Nadja, dreissig Seiten widmen.
Das klingt für den Laien vom Umfang her überschaubar. Was aber machen Sie bei einem Schreibstau?
Derartiges kenne ich nicht. Ich kann auch nicht nachvollziehen, wie einem das passieren kann. Bei mir ist es noch nie vorgekommen, dass ich nicht weiterschreiben konnte. Ich glaube, ich habe meinen Geist und meinen Körper so sehr ans Schreiben und Zeichnen gewöhnt, dass mir das gar nicht passieren kann. Ich bin, wenn Sie so wollen, sehr organisiert. Es vergeht wirklich kein Tag, an dem ich nicht acht bis zehn Stunden zeichne, schreibe und lese. Ich habe übrigens auch nie Ferien, ich arbeite immerzu. Das übrigens ausschliesslich, weil mir diese «Arbeit» so viel Spass macht.