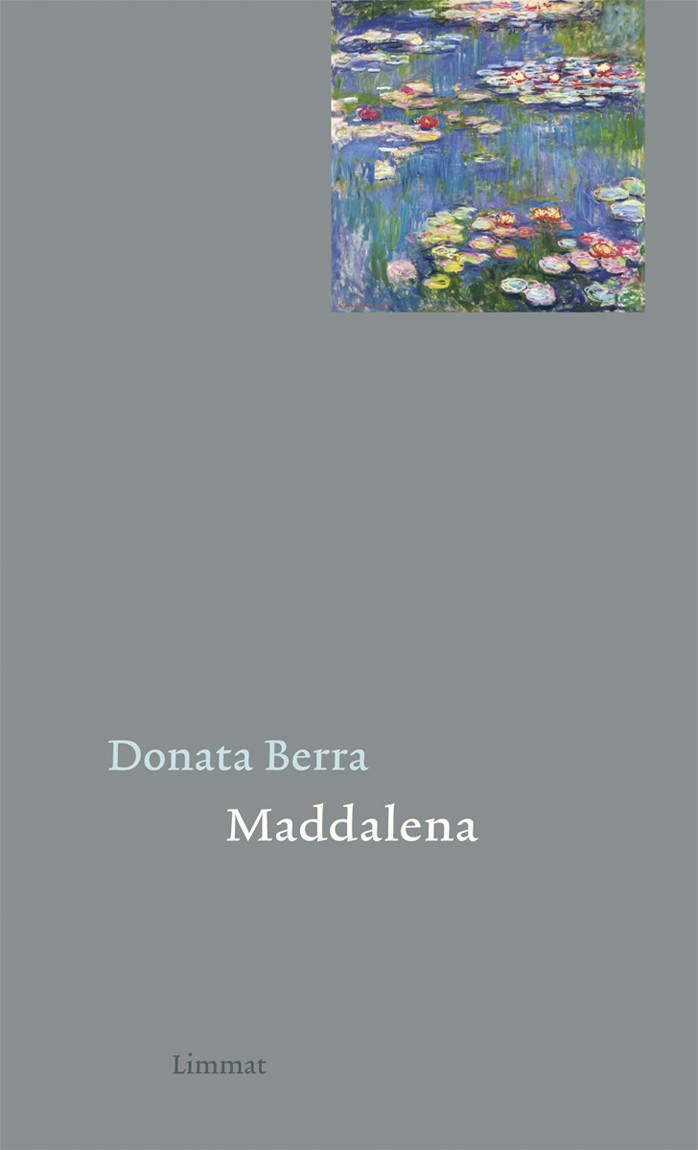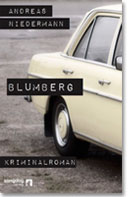Kein finsterer Mensch
Der für seine düsteren Schabkartonbilder schweizweit bekannte Zeichner Hannes Binder blickt zurück auf ein Leben zwischen «Globi» und Glauser. Im grossen Gespräch erklärt der Altmeister, was Bilder Worten voraushaben – und umgekehrt.

Herr Binder, haben Sie als Kind Comics gelesen?
Nun, zu meiner Zeit gab es ja eigentlich nur den «Globi» – und der war bei uns zuhause tabu, «pfui!». Mein Vater war Lehrer an der Kunstgewerbeschule und hat den Vogel natürlich als Werbefigur entlarvt. Diesen schlechten Geschmack hat man mir als Kind nicht zugemutet, und auch «Mickey Mouse», eine damals bereits recht populäre Comicfigur, liess ich aus.
Heute sind Sie einer der bekanntesten Zeichner der Schweiz – wann und wie haben Sie denn doch noch zum Comic gefunden?
Das war 1968, in Mailand. Nach der Künstlerklasse in Zürich bin ich losgezogen, um als Grafiker und lllustrator zu arbeiten. In dieser Phase bin ich den Arbeiten von Guido Crepax begegnet und dadurch so richtig zum Fan geworden. In seiner «Valentina» – so hiess die Titelfigur seiner Comicserie – brach Crepax das Bild auf und rhythmisierte die ganze Seite auf sehr freie Art; das hat mich ungeheuer beeindruckt. Genauso wie seine literarische Bewandtnis – Crepax’ Frau war Germanistin – und der spielerische Umgang, den er in seinen Literaturadaptionen mit den Stoffen pflegte. So etwas ist äusserst selten und wurde folglich auch nicht von vielen verstanden; er blieb mit seinen Werken eine Randerscheinung. Das ist überhaupt eines der Kernprobleme: je komplexer und interessanter es wird, desto weniger Leser findet man.
Komplexität? Gemeinhin verbindet man das Genre eher mit dem Gegenteil: Dem Comic haftet der Ruch des Trivialen an. Bilder, ist man als Wortfreund versucht zu sagen, sind Stoff für Lesefaule.
Ich würde das Gegenteil behaupten und sagen: gute Bildergeschichten sind Herausforderungen für Lernwillige. Beim Lesen einer Graphic Novel muss man zwei Sprachen kombinieren, das heisst: nicht nur lesen, sondern auch schauen. Diese Doppelung verlangt dem Leser sehr viel ab, er hat eine zweifache Arbeit zu leisten und muss bereit sein, sich auf etwas einzulassen, was er vielleicht nicht auf Anhieb versteht – Bilder zu lesen ist ja etwas unglaublich Schwieriges. Wobei diese Komplexität natürlich längst nicht in allen Bildergeschichten gegeben ist. Heute bringt man auf diesem Gebiet vieles durcheinander – Literaturadaptionen, Graphic Novels, Comics, das sind natürlich eigentlich alles unterschiedliche Sachen.
Entflechten wir also das Gewirr: Was hebt eine Graphic Novel vom «gemeinen» Comic ab?
Der Comic ist eher eine Art visuelle Sprache, die Bilder sind dort fast Piktogramme und meist eingezwängt in kleine Panels. Die Graphic Novel hingegen bricht diese Enge eher auf und gibt dem Bild mehr Raum. Müsste ich sie also definieren, würde ich sie als Rückführung des Comics auf seine ursprüngliche Form bezeichnen: auf die Bildergeschichte, wie etwa Rodolphe Töpffer sie im 19. Jahrhundert geschaffen hat. Fast rembrandtmässig hat der Gebüsche oder Blattwerke ausgestaltet und literarisch-poetische Formulierungen derart mit künstlerischen Bildern kombiniert, dass die beiden Ebenen fast ineinander überflossen. Und entsprechend ändert sich auch das Lesetempo.
Das heisst konkret: Der Wegfall der seriellen Komponente, die den Comic prägt, entschleunigt das Lesen respektive Schauen? Oder ist es die Bildqualität, die den Unterschied macht?
Beides, glaube ich. Im Comic kann man, ohne zu verweilen, von Bild zu Bild springen – und entsprechend ist dann eben auch die Ausführung der Bilder: die müssen ja gar nicht schön gezeichnet sein, um den Leser durch die Geschichte zu führen. Bei einer Graphic Novel hingegen muss man sich Zeit nehmen, um ins Bild reinzugehen, einzutauchen und Dinge zu entdecken, die nicht angeschrieben sind. Man kann dann gewissermassen zwischen den Zeilen lesen.
Das Bild erfüllt also in Graphic Novels eine andere Funktion?
Ja, es dient in diesen Fällen nicht mehr nur als visuelles Signal, sondern es eröffnet idealerweise eine zweite Ebene.
Bleiben wir zunächst noch auf der Ebene der Geschichte: Welche inhaltlichen Unterschiede sehen Sie zwischen den verschiedenen Erzählformen?
Viele Zeichner, die mit dem Comic Geld verdienen wollen, bleiben – fast gezwungenermassen – ein Leben lang bei den Populärgeschichten, den Abenteuerstoffen mit Sex, Crime und Helikoptern. Das verkauft sich. Dieses Lustige, das Easy-Lockere, das dem Medium anhaftet, hat mich persönlich nie interessiert, diese Klischees waren mir immer zu blöd. Die Graphic Novel, wie Will Eisner sie in den späten 1970er Jahren zu zeichnen und zu nennen begann, setzt denn auch nicht auf knallige Geschichten. Eisner hat sich darauf beschränkt, seinen jüdischen Alltag in New York zu beschreiben – in Worten und Bildern, die ineinanderfliessen. In meinen Augen ist das die ideale Kombination.
Auffällig viele Graphic Novelists besprechen aber auch enorm schwere Themen, etwa Marjane Satrapi mit ihrer Erfolgsgeschichte zur iranischen Revolution. Wo finden Sie persönlich Ihre Stoffe?
Solche politischen Themen aufzunehmen, das garantiert natürlich ein aktualitätsbezogenes Interesse – wobei ich sagen muss, dass ich gerade Satrapi dann zeichnerisch doch wieder etwas stereotyp finde. Mir selber war immer klar, dass ich dann am dichtesten und am glaubwürdigsten bin, wenn ich aus dem eigenen Erfahrungsbereich erzähle. Ich wollte in meine Geschichten immer das «Hier und Jetzt» reinbringen, sie mit dem Lokalkolorit meiner Umgebung färben.
Ist das bis heute so?
Mein aktuelles Projekt trägt erst einen Arbeitstitel: Enigma. Aber ja: Auch hierin wird es um eine Erfahrung gehen, die ich selber als Zeichner mache, nämlich den Paradigmenwechsel, der mit der Computerisierung eingesetzt hat. Das Gefühl, von einer neuen Technik eingeholt und abgehängt zu werden, transportiere ich in andere Zeiten: Mein Ururgrossvater beispielsweise hat als Kammmacher etwas Ähnliches erlebt, als plötzlich die Kautschukkämme aufkamen. Und als sich in der Renaissance die Zentralperspektive durchsetzte, fürchteten viele Maler um den Wert ihrer scheinbar überholten Kunst. Solche Wandlungen gibt es immer wieder, und jetzt im Alter beginnt mich das sehr zu interessieren.
Die Themen aus Ihrer Lebens- und Erfahrungswelt bilden aber nur einen Teil Ihres Œuvres. Bekanntheit haben Sie insbesondere durch die Illustration und Adaption von Glauser-Büchern erlangt und diese anfänglich auch unter dem Titel «Krimi-Comic» erfolgreich verkauft. War das eine Konzession an den Massengeschmack?
Ich habe zwar immer sehr gerne meine eigenen Geschichten veröffentlicht – sah aber bald, dass sich davon nicht leben lässt, denn: Das hat die Leute einfach zu wenig interessiert. Ich habe deshalb recht früh eingesehen: Wenn ich mit dem Zeichnen, mit dem Comic, Geld verdienen will, muss ich mich der Literatur anschliessen. Und zwar mit einem Populärstoff. Es ist schön, eigene Geschichten zu machen, aber man bleibt meist drauf sitzen. Das war ja übrigens auch für Glauser der Anlass, Krimis zu schreiben; er brauchte ein Populärvehikel, um seine Stoffe, seine Anliegen unter die Leute zu bringen.
Sie beide litten also gewissermassen am selben Problem – war das der Grund dafür, dass Sie sich Glauser zugewandt haben? Und: Wie findet man überhaupt als Illustrator «seinen» Autor?
Bei mir passierte das anfänglich eher zufällig. Als Grafiker habe ich den Auftrag angenommen, Taschenbuch-Covers für eine neue Glauser-Ausgabe zu gestalten. Einmal auf Glauser gestos-sen, liess er mich nicht mehr los. Die Settings waren dicht und witzig, die Charaktere trefflich, die Dialoge grossartig und die ganze Umgebung so gut zu recherchieren, dass ich Lust bekam, damit zu arbeiten. Einen grossen Teil zur Faszination hat dann auch die Sprache beigetragen: das knorrige Deutsch, die Helvetismen, die jeder Lehrer rot anstreichen würde, kurz, dieses Sperrige, das hat mir einfach sehr gepasst.
Gerade die Sprache stellen wir uns aber auch als Stolperstein vor: Glauser pflegte einen sehr bildhaften Stil, oft entsteht bei ihm die Stimmung über die Beschreibung der Szenerie. Hat das Ihre Arbeit erleichtert oder vielmehr erschwert?
Ich kann wirklich sagen, dass ich mir mit Glauser meine Sporen verdient habe. Ich wollte kürzen, fand alles ein wenig umständlich. Die Lektorin verbat sich dies aber strikt. Sie meinte: «Genau das ist es. Das ist Glauser!» Es ist ein schmaler Grat zwischen Gewinn und Verlust in Literaturadaptionen. Man muss im Bild eine ähnliche Qualität bringen, wie sie die Sprache hat. Das ist eine Art Übersetzen in eine andere Sprache – die Bildsprache.
Dabei handelt es sich bei Wort und Bild nicht nur um unterschiedliche Sprachen, sondern um zwei verschiedene Medien. Können Sie genauer erläutern, wie der Übersetzungsprozess zwischen den beiden funktioniert?
Nimmt man einen Stoff mit literarischen Qualitäten, ist es notgedrungen so, dass man gewisse Dinge nicht mehr sagen muss, weil sie im Bild zu sehen sind; der Schriftsteller bleibt in gewissen Passagen also aussen vor. Wenn Glauser etwa in «Krock und Co.» zur Beschreibung einer Gewitterstimmung von einem Himmel spricht, der wie eine schlecht geputzte Wandtafel aussieht, dann kann ich das so nicht zeichnen. Eine tatsächlich gemalte Wandtafel würde das Verständnis behindern, den Leser in die Schule, also in die Irre, führen. Ich muss also ein anderes Bild, eine andere Assoziation finden, um solche Nuancen und damit eigentlich auch das auszudrücken, was zwischen den Zeilen steht.
Das Füllen eben dieser Lücken ist doch eigentlich eine der Freuden des Lesers. Etwas böse könnte man sagen: Herr Binder beraubt die Glauser-Leser ihrer eigenen Bilder.
Das ist tatsächlich ein Problem – so wie mir beim Lesen sofort Bilder kommen, imaginiert sich der Leser seine eigenen. Ich habe eine Zeitlang recht breit versucht, Literatur zu adaptieren, bin aber eigentlich inzwischen davon abgekommen. Nicht wegen der Konkurrenz zu den Leserbildern, sondern weil ich eingesehen habe, dass die sprachliche Kraft im Bild vielfach schlicht nicht zu bündeln ist. Meine Lieblingsgeschichte von Robert Walser etwa, «Kleist in Thun», die produziert dermassen magische Bilder – dem kommt man mit einer Abbildung einfach nicht bei. Der ganze Zauber geht verloren. Solche Übersetzungen habe ich aufgegeben, das hat keinen Wert.
Demnach funktionieren Sie antizyklisch, denn auf dem Markt erleben Literaturadaptionen gerade eine grosse Blüte – von der Bibel bis zu Marcel Proust kann man sich alles bebildert kaufen.
Es gibt gewiss ein paar sehr gute Adaptionen, auch einige, die ich bewundere. Aber das sind, ehrlich gesagt, die wenigsten. Sehr viele kann man schlicht vergessen. Proust zu zeichnen etwa – das ist komplett sinnlos! Dort muss man wirklich zurücklehnen und die Bilder im eigenen Kopf entstehen lassen; alles, was ein anderer beisteuert, ist da ein Störfaktor. Vielleicht lässt sich das verkaufen, weil es ein populärer Stoff ist, für mich aber kommen Adaptionen nur noch in wenigen Fällen in Frage.
Welche Literatur taugt denn in Ihren Augen zur Übersetzung in die Bildsprache?
Ein gutes Beispiel sind die «Schwarzen Brüder» von Lisa Tetzner. Das ist eine Geschichte mit einer spannenden Handlung, die für sich allein berührt, eine Story, die verfängt, auch wenn man sie kürzt. Daraus kann man etwas machen, was am Schluss für mich als Zeichner befriedigend ist, weil ich den Lesern zum Beispiel zeigen kann, wie das Verzascatal oder das historische Mailand ausgesehen haben. In diesen Fällen ist der Text auch nicht unantastbar; man kann ihn kürzen, neu fassen, um nicht mehr in vielen Worten zu beschreiben, was man dann auch auf dem Bild sieht.
Das Bild wäre in diesen Fällen also eher ein Abbild als eine Interpretation – oder wie würden Sie die Funktion des Bilds respektive seinen «Mehrwert» im Vergleich zum reinen Wort beschreiben?
Grundsätzlich sehe ich das Bild immer als Träger von Symbolen, die benannt sind, ohne dass man es dezidiert merkt. Bilder bieten wunderbare Möglichkeiten, Pforten zum späteren Textverlauf zu öffnen, etwas einzuleiten oder vorauszunehmen, was den Text im späteren Verlauf prägt. So etwas ist auch sehr reizvoll zu zeichnen, denn häufig entdecke ich solche möglichen Symbolbezüge erst im Verlauf der Illustrationsarbeit.
Wie hat man sich diese Arbeit plastisch vorzustellen, haben Sie vorbereitend so etwas wie ein Drehbuch?
Ja, einen Aufmarschplan mache ich mir schon, nur nützt er häufig nichts, weil er sich eben ständig verändert: Plötzlich sehe ich in meinen eigenen Zeichnungen wieder etwas, was ich zwar nicht beabsichtigt habe, das aber ganz genau passt – und alles umkrempelt. Wichtig ist mir zudem, vor Ort zu gehen, an die Schauplätze, an denen die Geschichten spielen. Immer finde ich dort noch Dinge, die ich mir gar nie hätte vorstellen können.
Sie sind also gewissermassen ein Forschungsreisender…
…der Exkursionen in die Gebiete der Sprache und des Bildes unternimmt, genau! Wobei für mich die Priorität ganz klar beim Bild liegt. Mir dient das Wort hauptsächlich dazu, die einzelnen Bilder zu verknüpfen. Natürlich habe ich im Verlaufe der Zeit gelernt, wie wichtig das Wort auch als eigenständige Möglichkeit ist, wie gewinnbringend es sich aufs Ganze auswirken kann. Die Geschichte zum «Venediger», einem Album über Tintorettos Lehrling, etwa hat mir Klaus Merz komplett neu geschrieben – nachdem ich ihn nur um ein Vorwort gebeten hatte… Primär aber muss in meinen Augen eine gezeichnete Geschichte rechtfertigen, dass sie visuell erzählt wird. Es gibt zahllose Graphic Novels, die man genauso gut nur hätte schreiben können, das Bild ist in diesen Fällen keine Bereicherung. Hier möchte ich einen Unterschied festmachen: an sorgfältig gearbeiteten und komplexen Zeichnungen.
Ihr Zeichenstil – der dunkle Schabkarton – ist unverkennbar und lässt spontan an einen Film noir denken. Hat ursprünglich auch diese Technik die Wahl des Genres, die Hinwendung zum Krimi, beeinflusst?
Das Schwarz-Weisse dramatisiert natürlich, das ist klar. Mein Stil, der Schabkarton, ist mir aber Fluch und Segen zugleich. Einerseits schränkt er mich von den Themen her enorm ein. Bilderbücher für Kinder etwa sind so recht schwierig zu gestalten, für den Krimi hingegen bietet es sich wiederum an. Und ja, das Zwielichtige gefällt mir sehr. Viele Leute vermuten aufgrund meiner Bilder, ich sei auch ein finsterer Mensch, das stimmt aber natürlich nicht!
Das können wir bis hierhin nur bestätigen. War denn Heiteres oder Farbiges gar nie eine Option für Sie?
Bei jedem Bilderbuch taucht die Frage wieder auf: «Hannes, möchtest du es diesmal nicht vielleicht farbig machen?» Ich habe Versuche unternommen und musste sehen, dass die Resultate weder besser noch schlechter waren als vieles andere, was so produziert wird. Farbig falle ich also einfach nicht auf. Und damit wären wir nun bei der Segen-Seite des Schabkartons: der hohe Wiedererkennungseffekt. Ich bin jetzt einfach der schwarze, der geschabte Binder. Ich weiss ja, dass man sich in der Kunst erneuern muss. Ich habe aber wider allen Rat an meiner Technik festgehalten, und am Schluss hat sich das ausgezahlt: Ich bin inzwischen quasi mein eigenes Label – «Ich bin der Binder».
Wann haben Sie gemerkt, dass Sie darauf setzen müssen – auf das Geschabte?
Da ist vieles zusammengefallen. Ich hatte 25 Jahre lang gemalt und regelmässig ausgestellt – nur hat das kaum jemand gemerkt. Auf den Schabkarton aber gab es immer Echo und Resonanz, und zwar je länger, je mehr: Je stärker sich das Zeichnen durch den Computer perfektionierte, desto verrückter fanden es die Leute, dass einer das noch von Hand macht. «Wie lange haben Sie denn…?!», lau-tet immer die erste Frage, und ich kann immer nur antworten: «Was habe ich denn davon, wenn ich fertig bin? Was soll ich dann machen?» Mir ist egal, wie lange der Prozess dauert. Aber das versteht heute niemand mehr. Die Jungen wollen immer möglichst schnell fertig sein und Erfolg haben.
Vielleicht ist das nicht nur eine Frage von Alter und Jugend, sondern auch von Aufwand und Ertrag: Wie sichert man sich als Comiczeichner sein Auskommen?
Jetzt, mit 65, ernte ich die Früchte all meiner Versuche und kann es mir auch leisten, etwas abzulehnen, was ich früher sicher gemacht hätte – um Geld zu verdienen. Lange Zeit konnte auch ich die schönen Dinge, das, was ich wirklich umsetzen wollte, nur am Rande machen. Viele Zeichner, die ich noch von früher kenne, haben mittlerweile den Beruf aufgegeben, weil sie nicht davon leben konnten. Nur spricht man von denen nie. Ein Populärmedium hat leider den Nachteil, dass man immer nur die Neuen begleitet – und diese dann meist, wie eine Newcomer-Band, nach dem zweiten Album wieder fallenlässt. Die Comicszene gleicht einem riesigen Durchlauferhitzer, und ältere Zeichner haben darin häufig auch etwas Tragisches. Man kann nicht alt werden mit dem Comic.
Wenn Sie nun gewissermassen als Bob Dylan – als einer der wenigen, die in Würde altern konnten – auf die aktuelle Schweizer Comicszene blicken, wie beurteilen Sie dann deren Qualität?
So richtig überblicke ich die zwar nicht, insgesamt habe ich aber den Eindruck, dass sich in der Deutschschweiz seit rund 30 Jahren nicht viel geändert hat. Damals, gewissermassen zur Stunde null des Schweizer Comics, hat sich eine junge Genera-tion von Zeichnern diesem Medium zugewandt – doch viele sind gescheitert. Die Hoffnung, dass in Zukunft noch viel passiert, habe ich fast ein wenig aufgegeben. Ich finde es auch erstaunlich, dass man die grossen Talente, wenn sie denn mal da sind, fast schon als selbstverständlich hinnimmt. Sehr selten findet man diese Gaben in Personalunion.
Das kann doch manchmal auch gut sein. Der Rezensent richtet sich ja vorab an den Leser, nicht an den Produzenten.
Klar, der Rezensent muss ein ahnungsloser Leser sein. Trotzdem dürfte man unterstreichen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, einen guten Roman mit einem interessanten Plot und einem funktionierenden Spannungsbogen zu schreiben und auch noch zu bebildern!
In der Westschweiz scheint die Szene um einiges dynamischer zu sein als in der Deutschschweiz. Woher rührt dieser comictechnische Röstigraben?
Die einfachste Erklärung liefert der Zwinglische Bildersturm: Wir haben damals mal aufgeräumt mit den Heiligenbildli – im Bereich der Bibel hat die ganze Illustration ja überhaupt begonnen – und tun uns jetzt schwerer damit, sie frisch zu kultivieren.
Gerade im ähnlich protestantischen Deutschland wenden sich zurzeit aber viele auch renommierte Verlage den Graphic Novels zu – macht Ihnen diese Entwicklung etwas Hoffnung?
Ehrlich gesagt: nicht wirklich. Der Buchhandel braucht Etiketten. Als ich vor zwei Jahren hörte, dass der Suhrkamp-Verlag eine neue Schiene mit Graphic Novels lanciert, war ich sehr erstaunt und erfreut. Als ich mich dann aber in Frankfurt umgeschaut habe, tat ich das vergeblich: null und nichts hatte der Verlag auf diesem Gebiet zu bieten. Mittlerweile hat sich die Absichts-erklärung materialisiert, z.B. in Marcel Beyers «Flughunde». Ich glaube dennoch: das ist ein aufgebauschter Hype. Die werden schnell merken, dass solche Bücher die Verkaufserwartungen nicht erfüllen. Leider! Aber wer weiss, ob sich die Lage nicht doch einmal noch ändert: In meinem Nachtgebet wünsche ich mir immer, dass irgendwann mehr Leute den Reiz der doppelten Lektüre erkennen.