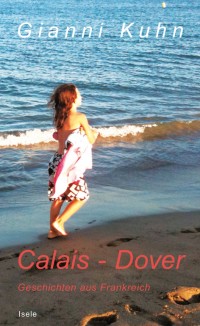Im Selbstreflexionskäfig
Viele Arbeitsschritte im Alltag von Journalisten haben etwas Erbsenzählerisches: transkribieren, alle Fakten doublechecken, zig Durchgänge machen durch den Text, die nur darauf abzielen, ihn ohne Substanzverlust um 500 Zeichen zu kürzen. Wieso tut man sich das an? Der Antrieb ist nicht der Text, sondern das Geschehene. Etwas Reales. Mit Sprache kann man Reales nur vermitteln. […]
Viele Arbeitsschritte im Alltag von Journalisten haben etwas Erbsenzählerisches: transkribieren, alle Fakten doublechecken, zig Durchgänge machen durch den Text, die nur darauf abzielen, ihn ohne Substanzverlust um 500 Zeichen zu kürzen. Wieso tut man sich das an? Der Antrieb ist nicht der Text, sondern das Geschehene. Etwas Reales. Mit Sprache kann man Reales nur vermitteln. Die Wiedergabe ist unmöglich. Das journalistische Schreiben versucht asymptotisch der Realität – respektive einem Fitzelchen Realität – nahezukommen. Es ist vom Diskurs geprägt und der Realität verpflichtet.
Wer literarisch schreibt, setzt hingegen etwas Anlassloses in die Realität. Der Text steht im Vordergrund; der Bezug zur Welt ist offen: Konfrontation mit der oder Flucht vor der Realität können Antrieb solchen Schreibens sein. «Hypersincerity» – Literatur, die behauptet, sie gebe in all ihren Facetten die privateste Wahrheit wieder – tut einer Gesellschaft so gut wie Google-Translate-Fake-News aus der Fake-News-Welthauptstadt Veles, Mazedonien. Der bekannteste «Hypersincerity»-Autor Karl Ove Knausgård erzählt auf hunderten Seiten, wie distanziert er seiner Familie begegnet. Knausgårds Kinder wachsen in einer Welt auf, in der alle Knausgård-Leser wissen, dass ihr Vater behauptet, er liebe sie nicht. Was löst es im Schreibenden aus, solche vorbeiflimmernden Gedanken in einem Text abzudichten? Was löst es in den Lesenden aus? Wer nur aus dem Fundus privater Realität zehrt, der wird zwangsweise zum Propagandisten für den Rückzug ins Private. Natürlich kann man auch in dasselbe Propagandaheer eintreten, wenn man keinen Bezug zur eigenen Lebenswelt schafft. Um was es mir beim Schreiben geht: den eigenen lebensweltlichen Fundus verzwecken, um zu hinterfragen und gesellschaftliche Verhältnisse aufzuzeigen. Der Ich-Erzähler in meinem Roman «Land ganz nah» ist in diesem Knausgård’schen Selbstreflexionskäfig gefangen. Ich wollte zeigen, wie handlungsunfähig so ein «Ich» bliebe, wenn die heile Insel der urban-dekadenten Schweiz auseinanderfallen würde. Ich bin froh, bin ich nicht dieses «Ich». Ich bin froh um Fiktion. Sonst gäbe es nur eine unpragmatische, unjournalistische Textform: die Selbstbespiegelung.
Benjamin von Wyl ist Journalist und Autor. Sein Debütroman «Land ganz nah» erschien dieses Jahr bei lectorbooks.