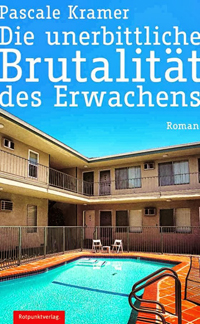Kriegsbegeisterung und Grenzkoller
Zwischen 1914 und 1976 haben sich hiesige Autoren auf vielfältige Weise mit dem erhofften, durchlebten, stilisierten oder verdammten Krieg auseinandergesetzt. Ein Spaziergang durch Kriegstexte aus helvetischen Federn.

I Die Anfangseuphorie: «Tiefe» erleben
Wie die Autoren der kriegführenden Länder begrüssen auch die Schriftsteller der deutschen Schweiz den Beginn des Ersten Weltkriegs mit Begeisterung; sie verstehen ihn als Ende einer alten, muffig gewordenen Zeit und als Chance für ein neues, tieferes Verständnis ihrer Existenz. Die Aussicht, jung sterben zu müssen, zwingt sie zur konzentrierten Wahrnehmung der Lebenszeit, die ihnen vielleicht noch bleibt; sie lässt sie die Gegenwart intensiver erleben als vor dem Krieg. Die Autoren sehen sich jetzt in der Lage, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Mit dem Wesentlichen kann die Aufgabe der Ichhaftigkeit oder das Aufgehen in ein das Individuum übersteigendes Ideal gemeint sein: Immer geht es darum, als einzelner oder als Nation über sich selber hinauszuwachsen – Ideale, von denen die Autoren glauben, sie seien in der Vorkriegszeit verlorengegangen.
So beschreibt Karl Stamm in seinem Gedicht «Geschenk der Zeit» (1915) diese Jahre als müden Frieden, als Zeit, die keine Tiefe und kein Erleben kannte und in der viele sinnlose Worte gesprochen wurden. Doch jetzt habe der Krieg den Zugang zum Leben wieder freigemacht: «Du hast den Born erschlossen, / darin das Leben schlief! / Des Krieges furchtbar: Werde! / die Quellen ins Dasein rief.» Auch Felix Moeschlin verdankt dem Krieg ein neues Erleben von Tiefe: «An der Grenze stehen, das heisst für uns: an der Grenze des Lebens stehen! Das ist das Tiefe, was uns zu erleben vergönnt war!»
Der Tagebuchschreiber in Hans Zurlindens «Symphonie des Krieges» (1919) erwartet vom Krieg eine Befreiung von der Beschäftigung mit sich selbst und ein Aufgehen im Grossen des Weltgeschehens. Jetzt sei Schluss mit dem «dummen Fragen nach dem Sinn und Zweck meines Daseins in der Welt. War das auch beschränktes Denken! Was habe ich denn noch zu bedeuten angesichts des ungeheuren Weltereignisses! Jetzt versinke liebe, eigene, kleine Persönlichkeit und passe bloss auf, was vorgeht.»
Wolf, der Protagonist in Meinrad Inglins (erst nach seinem Tod veröffentlichten) Erzählung «Phantasus», erlebt den Kriegsausbruch in Deutschland und ist begeistert von den «machtvollen Dingen», die dort getan werden: «Helden erstanden, Kleine wurden gross, Eigensüchtige lernten opfern, Zerstreute erkannten den Wert der Hingabe; der Sinn des Daseins wurde umgedeutet, Völkerideen triumphierten über Fleisch und Blut der einzelnen.» «Trunken vor Begeisterung» kehrt er in sein Heimatland zurück in der Hoffnung, hier möge dasselbe geschehen. Auch seine Na-tion (die Schweiz) soll über sich selbst hinauswachsen und Grösse anstreben. Dieser «Völkeridee» habe sich der einzelne unter der Führung einer aristokratischen Elite zu unterwerfen. Wolf strebt einen autoritären Führerstaat an, ein politisches Konzept, mit dem auch der junge Inglin sympathisiert.
Doch der Krieg dauert nicht, wie man gehofft hat, nur einige wenige Monate. Die Begeisterung verfliegt: Über längere Zeit lässt sich «gesteigerte Existenz» nicht erleben – erst recht nicht unter den harten Bedingungen des Militärdienstes. Zurlindens Tagebuchschreiber wird bei einem Deutschlandbesuch keine Soldaten finden, die vom Krieg begeistert sind, Stamm wird
ergreifende Gedichte über Soldaten schreiben, die einsehen müssen, dass sie im nationalen Rausch zu Mördern geworden sind, und Inglin wird sich im «Schweizerspiegel» von seinen Phantasien nationaler Grösse distanzieren.
II Die Armee als Erziehungsanstalt: «Füsilier Wipf»
Neben der schweizweit immer noch dominierenden Heimatliteratur entsteht im zweiten Kriegsjahr ein neues literarisches Genre: der Grenzwachtroman. Er thematisiert den Alltag der Schweizer Soldaten in den Kriegsjahren. Doch gibt die schweizerische Grenzwacht nur einen «recht bescheidenen und mageren Heldengesang» ab, wie der Zürcher Literaturwissenschafter Robert Faesi in seinem Aufsatz «Die Dichtung der deutschen Schweiz und der Weltkrieg» (1922) befand. Wenn es keine Heldentaten zu erzählen gibt, wovon soll er handeln? Faesi hat mit seinem «Füsilier Wipf» (1915, 1917, zweite, veränderte Auflage 1938) den Weg gewählt, den Grenzdienst als Bewährungsprobe auf kleinem Feuer zu beschreiben.
Reinhold Wipf ist Coiffeurgeselle, ein schmächtiger, schüchterner und wenig viriler junger Mann – keine guten Voraussetzungen, um im Militärdienst zu bestehen. Von den «Kameraden» wird er höchst unkameradschaftlich behandelt – sie sehen in ihm den Sündenbock, an dem sie ihre Frustrationen über den Dienst ausleben können –, von den Vorgesetzten schikaniert. Schon kurz nach dem Einrücken erhält er zwei Tage Arrest. In der dunklen Zelle erfährt er seine Katharsis: Er beschliesst, durchzuhalten, will den andern zeigen, wozu er fähig sei. Tatsächlich wächst Wipf «immer besser in seine Marschschuhe hinein». Wipf wird zum Vorzeigesoldaten; er weiss, dass das Wesen des Soldatentums darin liegt, «dass man durch dick und dünn unbedingt und unerbittlich gegen sich selbst bis zum Ende gehe». Gegen den Schluss der Erzählung dankt Wipf dem Vaterland dafür, «dass es ihn aus seinem muffigen Winkel zur rechten Zeit in die Schule genommen und auf Wanderschaft geschickt […]», also zum Mann und Soldaten gemacht hat.
Doch verdient das Vaterland diesen Dank? Der Beitrag der Armee an Wipfs Entwicklung beschränkte sich darauf, ihm die schlechten Bedingungen geboten zu haben, die ihn zwangen, um sein Überleben zu kämpfen. Sie hat seine Widerstandskräfte mobilisiert; erzogen aber hat sich Wipf aus eigener Kraft. Schule der Männlichkeit ist die Armee insofern, als sie durch Härte männliches Verhalten provoziert. Füsilier Wipf rechtfertigt die Erziehungsdoktrin General Willes: Wenn preussischer Drill, Autoritätsgehabe der Offiziere und Schikanen der Unteroffiziere bei einem so schlechten Soldaten einen so durchschlagenden Erfolg erzielen, erfüllen sie ihren Zweck.
III Ein Gegenwipf: «Füsilier Sonderegger»
Hermann Weilenmann, der Autor der Prosadichtung «Der Befreier» (1918), ist bei Kriegsausbruch ein 21jähriger Geschichtsstudent. Sein Protagonist ist etwa gleich alt; man kann annehmen, dass Weilenmann in ihm seine eigenen Erfahrungen mit dem Militär verarbeitet.
Füsilier Sonderegger ist ein «feingebauter» Musiker. Wie Füsilier Wipf vor seiner Wandlung ist er für den Militärdienst wenig geeignet. Anders als dieser ist er ein selbständiger Denker. Beim Anblick der Alpen erkennt er, dass die Soldaten vor den Offizieren ihre Freiheit fahren lassen und dass die Schweiz in Herrscher und Beherrschte eingeteilt ist. Darum will er ein Buch über die Freiheit schreiben. Sonderegger ist in diesem Moment einer der für die expressionistische Literatur typischen Weltverbesserer. Anders als diese scheitert er aber nicht daran, dass die Welt von ihm nichts hören will. Er wird, im wörtlichen Sinn, irr an der Spannung zwischen seinem Denken und einem mächtigen militärischen Männerbild, dem er sich nicht entziehen kann.
In einem Manöver erlebt er wie die andern Soldaten den Kampfesrausch. Er versteht nun, dass diese keineswegs unfrei handeln, sondern sich im Kampf ihre Männlichkeit bestätigen. Er will sein wie sie. Hätte Faesi dieses Buch geschrieben, so wäre es an dieser Stelle zu Ende.
Doch Weilenmann gibt der Geschichte eine andere Wendung. Mitten in einer Pause sieht Sonderegger Feinde vor sich, stürzt sich mit dem Gewehr auf sie und fällt in einen Abgrund. Er handelt im Wahn; etwas später stirbt er an den Folgen einer Blutvergiftung. Das militärische Männerbild hat von Sonderegger Besitz ergriffen und ihn in den Tod getrieben. «Der Befreier» ist das Gegenstück zu «Füsilier Wipf»: Sonderegger scheitert mit seinem Versuch, dem Männerbild zu entsprechen. Für den sensiblen Künstler ist es eine zerstörerische Macht. Im Unterschied zu «Füsilier Wipf» ist «Der Befreier» ein Werk von literarischer Kraft und sprachlicher Originalität – ein herausragender Text, der einen Platz in der Schweizer Literaturgeschichte verdiente.
IV Das Feuer neu entfachen: «Wipf», zweite Auflage
Nach 1933 steht die Schweiz unter dem Eindruck von Hitlers Machtergreifung; man hat Angst vor einem neuen Krieg. Die «geistige Landesverteidigung» fordert eine Besinnung auf die Grundwerte der Schweiz und die Überwindung der Klassengegensätze. 1938 kommt «Füsilier Wipf» in die Kinos und wird zu einem Riesenerfolg. Auf der Basis des Drehbuchs schreibt Faesi eine zweite Fassung seiner Erzählung, die einige neue Elemente aufnimmt. Jetzt werden die lange Dauer des Krieges und mit ihr der Grenzkoller zum Thema. Auch erhält Wipf in Füsilier Leu einen väterlichen Freund. Leu ist der Inbegriff des «gesunden» Schweizer Mannes; ihm fällt denn auch die Aufgabe zu, in einer schwierigen Situation das richtige Wort zu finden.
Die Soldaten sitzen um ein Feuer, das langsam erlischt. Keiner mag neue Scheiter auflegen: Wipfs Zug hat den Grenzkoller. Leu beginnt zu sprechen, zuerst mehr für sich. Mit der Heimatliebe sei es wie mit diesem Feuer. Sie sei jetzt am Erlöschen, aber noch gebe es Glut. Diese müsse neu angefacht werden. Leu zählt darum auf, was alles für die Unabhängigkeit der Schweiz spreche: keine fremden Richter, keine fremden Generäle und auch keine fremden Schulmeister, die dem Land ihre Lehren aufzwingen würden. Diese Freiheit lohne es wohl, verteidigt zu werden. Die Szene endet mit dem gemeinsamen Singen des Beresinaliedes.
In der ersten Fassung des Buches ging es vor allem darum, die Leser vom Wert der militärischen Erziehung zu überzeugen. Die Verteidigung der Freiheit des Vaterlandes war als Selbstverständlichkeit mitgedacht. Mit der zweiten Fassung soll die Bevölkerung ideologisch mobilisiert werden. Dazu eignet sich die Vaterlandsliebe besser als General Willes umstrittener Erziehungsstil.
V Die Kameraden brauchen dich: Inglins «Schweizerspiegel»
Meinrad Inglins «Schweizerspiegel» (1938) ist die Summa der Deutschschweizer Literatur über den Ersten Weltkrieg. Es finden sich hier alle wichtigen Motive seiner Vorgänger-Romane: Grenzwachtdienst, preussischer Drill, Klassenspaltung und Vater-Sohn-Konflikt.
Paul Ammann ist zu Beginn des Romans ein etwas müder und skeptischer Intellektueller, der sich nicht so schnell hinreissen lässt. Doch dann wird er bei der Vereidigung kurz nach dem Einrücken von seinen Gefühlen überwältigt. Auch er findet jetzt den Krieg grossartig. Sein Freund, der Dichter Albin Pfister, würde es vorziehen, wenn all das nur ein Traum wäre. Ihm entgegnet er: «Ja, aber man sollte diesen Traum nicht träumen, sondern erleben. Ich meinerseits will nun wirklich dabei sein, weisst du.» «Erleben» heisst für ihn jedoch nicht, Tiefe zu erfahren, sondern sich einzuordnen. Im Gegensatz zu Wipf erlebt Paul Kameradschaft, etwa wenn ihm ein stärkerer Kamerad bei einem anstrengenden Marsch das Gewehr abnimmt oder ein anderer ihm Wasser reicht. Unter diesen Leuten will er kein Fremdling sein.
In einer Gefechtsübung wirft sich Paul, von Ekel erfasst, in den Schnee. Er will nichts mehr «als hier liegenbleiben und verhungern oder erfrieren». Auch er hat den Grenzkoller. Sein
Vetter, der Bataillonsarzt René Junod, setzt sich zu ihm und beginnt zu sprechen. Er bittet Paul um Feuer, lässt seine Zigarette in den Schnee fallen, nimmt sich eine zweite Zigarette und bittet Paul nochmals um seine Zündhölzchen, ohne zu bemerken, dass er selber sie hat. Bevor er geht, schlägt er vor, Paul einen Dispens zu geben. Doch «Paul hakte sich den Tragriemen ein und schüttelte den Kopf. ‹Nein, ich gehe jetzt zur Kompa-gnie zurück›, sagte er und hob auch das Gewehr auf.»
Diese an sich belanglose Szene wird von Inglin so breit erzählt, dass man annehmen muss, sie sei ein Bild für etwas Unausgesprochenes. Tatsächlich versucht Junod mit keinem einzigen Wort, seinen Vetter moralisch aufzurichten. Er zeigt ihm aber durch sein ungeschicktes Benehmen, dass er auf ihn angewiesen sei, genauso wie Paul und seine Kameraden aufeinander angewiesen sind. Paul versteht den versteckten Sinn dieser Inszenierung und begibt sich wieder zur Truppe. Er erfährt Kameradschaft als Geschenk und Verpflichtung; seine Beziehung zu den Kameraden steht hier für die integrative Kraft der Armee.
VI Der Geist im Dienst: Frischs «Blätter aus dem Brotsack»
Wipfs Oberleutnant liebt es, mit seinen Leuten zu plaudern; es ist sein Ehrgeiz, sich in diesen Köpfen «und in dem grobgeschnitzten oder feinern Uhrwerk darin» auszukennen. Mehr als ein «feineres», also ein feines Uhrwerk erwartet er von den Soldaten allerdings nicht; das ist doch eher Leuten seiner Bildung (er ist Architekt) und seines militärischen Grades vorbehalten.
Als wolle er Wipfs Oberleutnant widerlegen, zeigt der gemeine Soldat und Architekt Max Frisch in seinen «Blättern aus dem Brotsack» (1940) ein überaus fein organisiertes Seelenleben.
Mögen die Offiziere Macht haben, er hat Geist und führt ihn in den Blättern vor. Sein Thema ist die «Wandlung», das stete Fortschreiten. Weil aber dazu meistens die «Spannkraft der Seele» fehle, seien starke Anstösse von aussen nötig: «Ohne das Grauen vor dem Tode, wie begriffen wir das Dasein? Alles Leben wächst aus der Gefährdung.» Das ist die Denkfigur, mit der schon 1914 die Lyriker die Angst vor dem Krieg zu bewältigen versuchen.
Zwar kann Frisch nicht wissen, wie er sich in der Gefährdung verhalten wird, eines aber sei gewiss: «Ehrlich werden wir sein, vielleicht zum erstenmal, ohne Maske, ohne erlernte Gebärden.» Zuletzt sei «es immer nur das eigene Gesicht, was wir fürchten, vielleicht mehr noch als den Tod, der uns auch zu Hause gewiss ist». Was heisst das alles? Vielleicht einfach bloss, dass da einer versucht, sich als Intellektueller in einer geistlosen Umgebung zu behaupten. Versucht, sich am Zopf des Geistes aus der beängstigenden Wirklichkeit herauszuziehen: «Im Grunde genommen kann es doch nur das eigene Herz sein, das letztlich entscheidet, ob es eine brache oder fruchtbare Zeit ist.» Das ist, angesichts der Kommandostrukturen der Armee, eine gleichzeitig sehr hochgemute und ichbezogene Sicht der Lage, sicher aber keine realistische.
Sechsunddreissig Jahre später und gestützt durch den aktuellen politischen Diskurs erinnert sich Frisch im «Dienstbüchlein» (1976) vor allem an Stumpfsinn, Leere, Untertänigkeit, politisches Desinteresse. Die Soldaten: unbewusst in den Tag hinein lebende Männer, die ihre Selbständigkeit abgegeben und sich jedes kritische Fragen abgewöhnt haben. Und die Versuche, sich mit Hilfe des Geistes zu retten? Das ganze Dienstbüchlein spricht davon, dass das Herz nicht stark genug war, die Zeit der Grenzbesetzung zu einer fruchtbaren zu machen, und dass aus dem steten Fortschreiten ein Treten an Ort wurde. Doch geht Frisch jetzt mit keinem Wort auf seine früheren philosophischen Höhenflüge ein. Hat da einer Angst davor, dass sich hinter dieser Maske ein ungeliebtes Gesicht verbergen könnte?