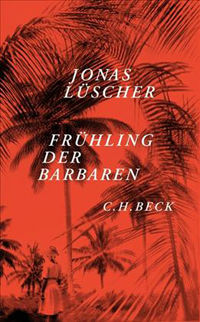Spitznamen – oder: Nomen omen est?
Wortwitze und Spitznamen, Sprachscherze und Anspielungen sind ein grandioses Spielmaterial für unseren Geist. Aber nur so lange, wie die davon Betroffenen mitlachen können. Die moralisch einwandfreieste Art des Lachens bleibt die Selbstironie.

François Bondy pflegte zu sagen: «Über alles darf man sich lustig machen, nur nicht über den Namen, den jemand trägt. Denn dafür kann einer nichts. Merke es dir: Über Familien-
namen kalauert man nicht!» – Der Menschheit aber ist nichts heilig, und sie vergnügt sich nicht nur, indem sie vom Namen auf Charaktereigenschaften schliesst, sondern sich auch noch im Erfinden von Spitznamen als übereifrig, einfallsreich und gleichzeitig als abgrundtief boshaft erweist. In traditionellen Dorfgemeinschaften, wo es häufig zahlreiche Personen mit identischem Familiennamen und Vornamen gab, hatten Spitznamen oft eine Unterscheidungsfunktion, die durchaus ihren praktischen Sinn hatte. Trugen mehrere Personen den Namen des Heiligen, dem die Pfarrkirche gewidmet war, und dazu einen im Dorf häufigen Familiennamen, so waren zusätzliche Bezeichnungen notwendig, um Verwechslungen zu vermeiden. Es brauchte also Beinamen, und diese hatten in der Regel ihren Ursprung in der Spottlust und in der Schadenfreude, nicht in der Menschenliebe und im Respekt vor anderen.
Natürlich gibt es auch Spitznamen, die geradezu als Ehrentitel gelten. Wenn der berühmteste Juwelendieb der Côte d’Azur den Beinamen «The cat – Die Katze» trug, wie wir aus Hitchcocks Film «Über den Dächern von Nizza» (Originaltitel: «To Catch a Thief») wissen, so war das in aufrichtiger Bewunderung gesagt für jemand, der wie eine schwarze Katze in der Nacht bei seinen Untaten unsichtbar blieb und tagsüber als Unschuldslamm auf einem Lehnstuhl vor Behagen vor sich hindöste. Hiess jemand «Peter der Grosse» oder «Iwan der Schreckliche», so entstand der Beiname nicht nur, um den Herrscher von weniger bedeutenden Vorgängern oder Nach-folgern zu unterscheiden, sondern auch um seinen gross-schrecklichen Taten Tribut zu zollen. Wenn die Verfasser und Übersetzer von «Asterix bei den Schweizern» für ihre Figuren Namen wie Claudius incorruptus, Agrippus virus und Feistus Raclettus wählten, so waren damit das schweizerische Bank-wesen, die chemische Industrie und die Essgewohnheiten heiter auf die Schippe genommen. Was François Bondy als moralisch grenzwertig bezeichnete, waren Namensgeschichten, die wir aus gewissen Witzen kennen, wo ein im Westen neueingebürgerter galizischer Jude nach Hause kommt und seinen Lieben mitteilt, ihr Familienname laute nunmehr «Schweiss». Worauf seine Frau verständlicherweise die Frage stellt, ob er denn keinen sympathischeren Namen für ihre Familie habe beschaffen können, und der Mann antwortet: «Wenn du wüsstest, was mich das W gekostet hat!» – Namensgebungen geschehen nicht nur aus Bosheit und aus dem Willen, den anderen zu erniedrigen. Als Student wohnte ich in München bei einer liebenswürdigen Familie, die den im deutschen Sprachraum gewöhnungsbedürftigen Namen «Kotzenbauer» trug. Honni soit qui mal y pense! Der Name hat gar nichts mit Erbrochenem zu tun und geht auf ein aus den Turksprachen stammendes «Kotzak» zurück, vermutlich mit dem stolzen Namen der Kosaken verwandt. Der Name bedeutete also so viel wie «der freie Krieger, der inzwischen zum ansässigen Bauern geworden ist». Die Monoglotten denken meistens falsch. Nur die Mehrsprachigen erfahren die Wahrheit! Freilich haben die beiden Töchter, als sie heirateten, nicht darauf bestanden, um jeden Preis ihren Mädchennamen zu behalten.
Dass Spott und Häme aber oft der Grund für Necknamen als Fremdbezeichnungen sind, lässt sich nicht leugnen. Dafür sind jene Namen der Beweis, welche die Bürger der Unterengadiner Gemeinden jeweils für die Einwohner des Nachbardorfes fanden. Gudench Barblan, Sekundarlehrer aus Sent, Dichter des Liedes «Chara lingua dalla mamma» – das Nationallied
der bündnerromanischen Ladiner! – und dazu Kantonspolitiker, hat diese wechselseitigen Spotthudeleien 1909 in der Zeitschrift «Annalas» publiziert. Das Spiel mit den Spitznamen
haben andere nach ihm weiterentwickelt, so dass inzwischen auch die Bewohner der Gemeinden des Oberengadins über Bezeichnungen verfügen, die zur intentionalen Beleidigungsstrategie gehören. Ich nenne hier nur einige: In Sent wohnen die Esel, in Scuol die Schweine, in Ftan die Ochsen, in Tschlin die Zigeuner, in Lavin die Kuhwürger, in Zernez die Hundefresser und in Tarasp (katholisch!) die Messenfresser. Um die Bezeichnungen zu rechtfertigen, hat man Legenden ersonnen, welche dem Spitznamen seine historische Glaubwürdigkeit
garantieren! Im Oberengadin, wo man «puter» spricht, hocken die Mehlbreifresser («put» ist eine Mehlbreispeise), und spezifischer: in Samedan die Schinder, in Celerina die Spekulanten, in Bever die Doktoren (nach ihrer speziellen Aussprache «duttugrs»), in Pontresina «ils pietigots», wegen ihrer besonderen Art zu grüssen. Und in der Surselva die zu Rätisch-Kongo gehörigen «tschilovers» (die vom anderen Wasser). Das alles ist so harmlos wie vergnüglich. Ein Rest von Eigenstolz schwebt darin, weil man immer schon davon ausging, dass in der Nachbarsgemeinde seit dem Mittelalter alle Kranken, Lahmen, Behinderten, Lasterhaften und geistig Beschränkten der ganzen Welt sich niedergelassen haben. Die Volkskunde weiss viel über Spitznamen zu berichten: warum die Luzerner «Katzenstrecker» und andere «Schweineschwanzdreher» heissen, warum die Obwaldner «Tschifeler» sind und die Nidwaldner «Reissäckler». Bis zum heutigen Tag setzen sich wenig schmeichelhafte Fremdbezeichnungen im Land fort. Die zürcherische Jugend nennt heute manchmal den Kanton Aargau «den Gaza-Streifen», während – Gegenrecht haltend – die Aargauer das stadtzürcherische Oerlikon als «Gfoerlike» titulieren.
Heikel wird Humor erst, wo er Einzelpersonen aufgrund ihrer körperlichen Beschaffenheit, gar ihrer Behinderung oder ihrer Verhaltensauffälligkeiten (Schwächen und Laster) anpeilt. Manche Spitznamen reichen weit über die Grenzen des Anstands hinaus und erreichen die Zonen seelischer Grausamkeit. Sie könnten justiziabel sein. Dass an jedem Gymnasium über Schülergenerationen sich vererbende Spitznamen für Lehrer bestehen, weiss man nicht nur in der Schweiz. Unsere hiessen Topf, Chäs, Fisch, Floh, Götti und Nero, und keiner
hat unter diesen Spitznamen in besonderer Weise gelitten. «Panki» war der Name für den liebenswürdigsten Pater des Klosters, der eigentlich Pankraz hiess, was wir für sein sanftes Wesen als einen zu kratzigen Namen hielten. Der Spitzname kann ein Kosename sein. Pater Ambros, in seiner Freizeit Ortsnamenforscher, wandte sich, nachdem er jede Mulde und jede Wiese der Region aufgrund der einheimischen Bezeichnungen dingfest gemacht hatte, auch den Spitznamen der oberen Surselva zu. Seine Ergebnisse waren so, dass er sich lange weigerte, diese zu publizieren. Ein zensurierter Privatdruck ist später dann doch in Umlauf gekommen. Als er mir ein Exemplar übergab, sagte er: «Zeige es niemand! Es ist nur für dich, weil du dich auch für Namenskunde interessierst!»
Meistens aber steckt hinter dem Spitznamen eine Bosheit. Den Klosterknecht, der immer eine schwarze Binde um ein Auge trug, nannten wir «Polyphem», der taubstumme Schneeschaufler und Strassenkehrer des Klosters hiess aufgrund der von ihm vernehmbaren Laute «Pidic», und ein anderer, mit einem Kropf versehen, hiess «Arnold dalla meltra» – was so viel bedeutete wie: jener mit dem Milchkübel. Spitznamen haben ihren Grund in vielerlei: familiäre Herkunft, berufliche Tätigkeiten, Unglücksfälle, Missgeschicke, auffällige Sprechweisen. «Ils wagners» hatten bei uns nichts mit Richard Wagner zu tun, sondern waren seit Menschengedenken die Hersteller von Rädern und Karren. «Ils ferbers» stammten aus einer Familie, die ursprünglich Wolle und andere nützliche Dinge färbten. Ils «actuars» kamen aus einer Sippe, die ihre Verdienste als Gerichtsschreiber und Notare hatte. Da es so viele Josefs, Giuseps und Seps gab, musste man, um sie zu unterscheiden, zu charakterisierenden Begriffen greifen. Und so hiessen sie: der Mobiliensep, der Sep der Sprünge, der Sep der Leintücher, der Hühnersep und der Doktor Sep. Wenn jemand häufig ein ungewohntes Wort brauchte, hiess er plötzlich so wie dieses Wort: zum Beispiel «Krambambuli». Sah jemand schlecht und krank aus, nannte man ihn «il 13 da troccas» – die 13. Karte
des Tarockspiels – das heisst: den Tod! Jemand, auf den der Verdacht des Frömmlings fiel, hiess «il prer da bizochels – der Spätzlipfarrer». Einer, den man immer mit einem «Toskana-Stumpen» antraf, hiess bald einmal «il toscanelli». Eine Frau mit einer seltsamen Fortbewegungsweise (sie lief schnell, stoppte auf einmal, lief plötzlich wieder weiter) hiess «Das Tram». Einen Mann, der aufgrund einer Nervenkrankheit den Kopf hin und her bewegte, nannte man «il tuttanana» – den Wiegenliedsänger. Mit den letzten Beispielen haben wir durch Verächtlichkeitslinguistik eindeutig den Bereich des moralisch Dubiosen betreten. Daneben kommen oft auch von der Allgemeinheit geschätzte Personen zu geradezu liebenswürdigen Spitznamen: So nannte man einen Mann, dem die gerechte Darstellung der katholischen Kirche in der Öffentlichkeit ein Anliegen war, respektvoll «Il cardinal dalla Scaletta» – wobei Scaletta der Name jenes Dorfteils ist, in welchem unser Mann wohnte.
Nomen omen est? Ist der Name ein Hinweis auf das, was eine Person ausmacht? Wortwitze und Spitznamen, Sprachscherze und Anspielungen sind ein grandioses Spielmaterial für unseren Geist. Aber nur so lange, wie die davon Betroffenen mitlachen können. Die moralisch einwandfreieste Art des Lachens bleibt die Selbstironie. Wie schrieb Christian Morgenstern? «Wer sich nicht selbst verspotten kann, der ist fürwahr kein ernster Mann.» Es dürfte auch für das weibliche Geschlecht gelten.