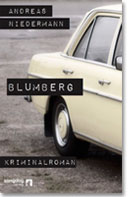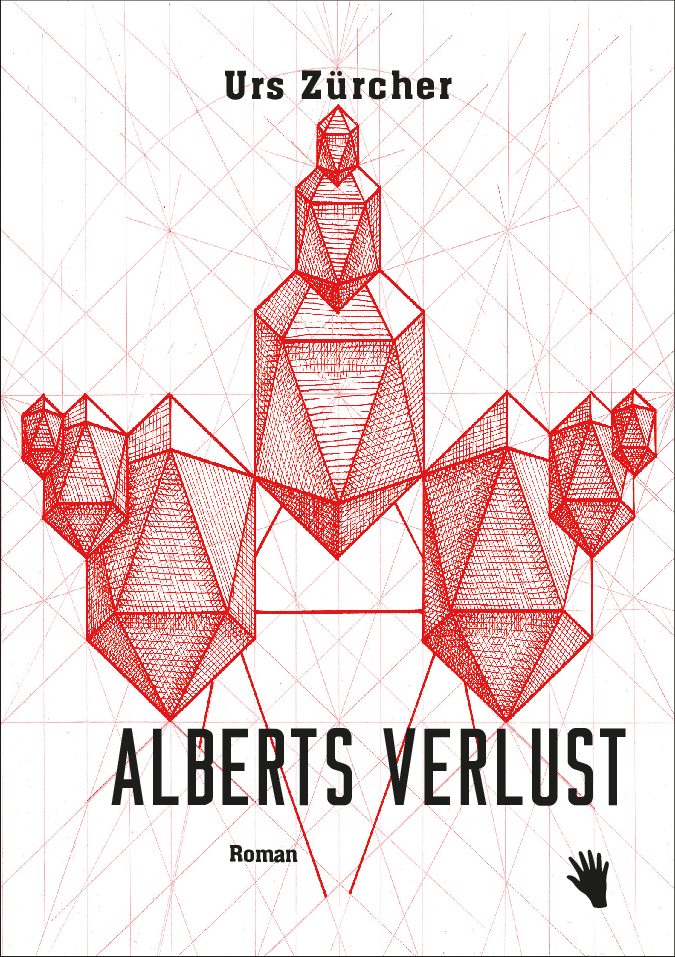Der Nebeljob
Nebenjob #1
Und dann kam der Nebel. Plötzlich. Er war über den Grat gekrochen und senkte sich über mich und meinen Hund, der mir ein paar Schritte voraus war. Das Tier verschwand im kühlen Gewölk. Mir stockte kurz der Atem. Ich ging weiter, mit nach vorne gebeugtem Oberkörper, den Pfad und seine Unebenheiten streng im Blick. Jetzt bloss nicht stolpern. Von meinen täglichen Rundgängen wusste ich, dass die Flanke zu meiner Linken jäh – über eine felsige Schulter hinweg – ins Nichts fiel.
Wie üblich war ich kurz nach Sonnenaufgang aufgestanden und hatte mich gleich aufgemacht, von meiner Hütte weit oben im Nanztal im Wallis, wo ich sommers die Schafe hütete, um mir mein Studium zu finanzieren, dem Höhenweg entlang Richtung Norden. Sieben Sommer sollte ich hier verbringen. Und bereits nach den ersten Hirtenmonaten wähnte ich mich in der Sicherheit, mich hier oben selbst geschlossenen Auges zurechtzufinden. Ich hatte mich getäuscht.
Ich watete vorsichtig weiter, bis zur Äusseren Nanzlücke, Öhr mehrerer Wanderwege. Ich schlug den Weg links zum Glishorn ein. Doch nach gut zehn Schritten blieb ich verwirrt stehen. Der scheinbar gekannte Pfad hatte seine Vertrautheit verloren. Die Landschaft glich einem riesigen, in irgendeinem Kellerabteil vergessenen und über die Jahre von Feuchtigkeit aufgeweichten Bündel Papier, auf dem die Schriftzeichen allmählich zerronnen und dann ganz verschwunden waren. Ich rang um Fassung. Dann rief ich dem Hund. Und erneut. Jedes Mal lauter – kein Echo.
Schweiss trat mir auf die Stirn, der Puls pochte in den Schläfen, mein Mund öffnete sich kurzatmig. Der Nebel legte ein gigantisches Gewicht auf meine Brust. Angsterfüllt rang ich um Luft.
Erst als es mir gelang, meine Konzentration wieder vermehrt auf die Einzelheiten zu lenken, die mich umgaben, kehrten Ruhe und Zuversicht in mich zurück. Mein Blick vertiefte sich im Nebel. Gelegentlich vermeinte ich, die feinen, schwebenden Wassertröpfchen auszumachen und darin die gesamte spektrale Aufsplitterung des Lichts, das sich in ihnen brach und sie dabei erst sichtbar machte. Einen Moment lang war ich mir gar sicher, so etwas wie die glitzernde Syntax des Nebels erkannt zu haben. Als zwischen den zackigen Felstürmen auf dem Grat über mir Wind aufkam und pfeifend den Nebel aufriss, erfüllte mich eine leise Wehmut.
Offenbar war ich genau an jene Stelle zurückgekehrt, an der mich der Nebel zuallererst eingehüllt hatte. Zunächst nur schemenhaft erkennbar, schälte sich auch der Umriss des Hundes, der die ganze Zeit über nur ein paar Schritte von mir entfernt auf dem schmalen Pfad gesessen hatte, aus dem Weiss heraus.
Gemeinsam setzten wir den Rundgang fort. Zur Nanzlücke. Zum Glishorn.
Noch heute denke ich, wenn ich beim Schreiben nicht weiterzukommen meine, an den Nebel zurück, der mich zwischen Innerer und Äusserer Nanzlücke die Orientierung verlieren liess, und es kommt mir vor, als ginge es eigentlich um nichts anderes, als die sich im Licht spiegelnden Gefüge des Nebels zu erkennen und sichtbar zu machen – Wort für Wort, Satz für Satz, Gedicht um Gedicht.