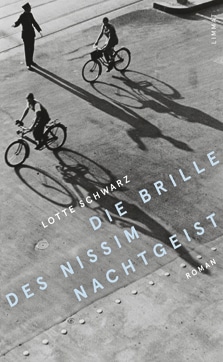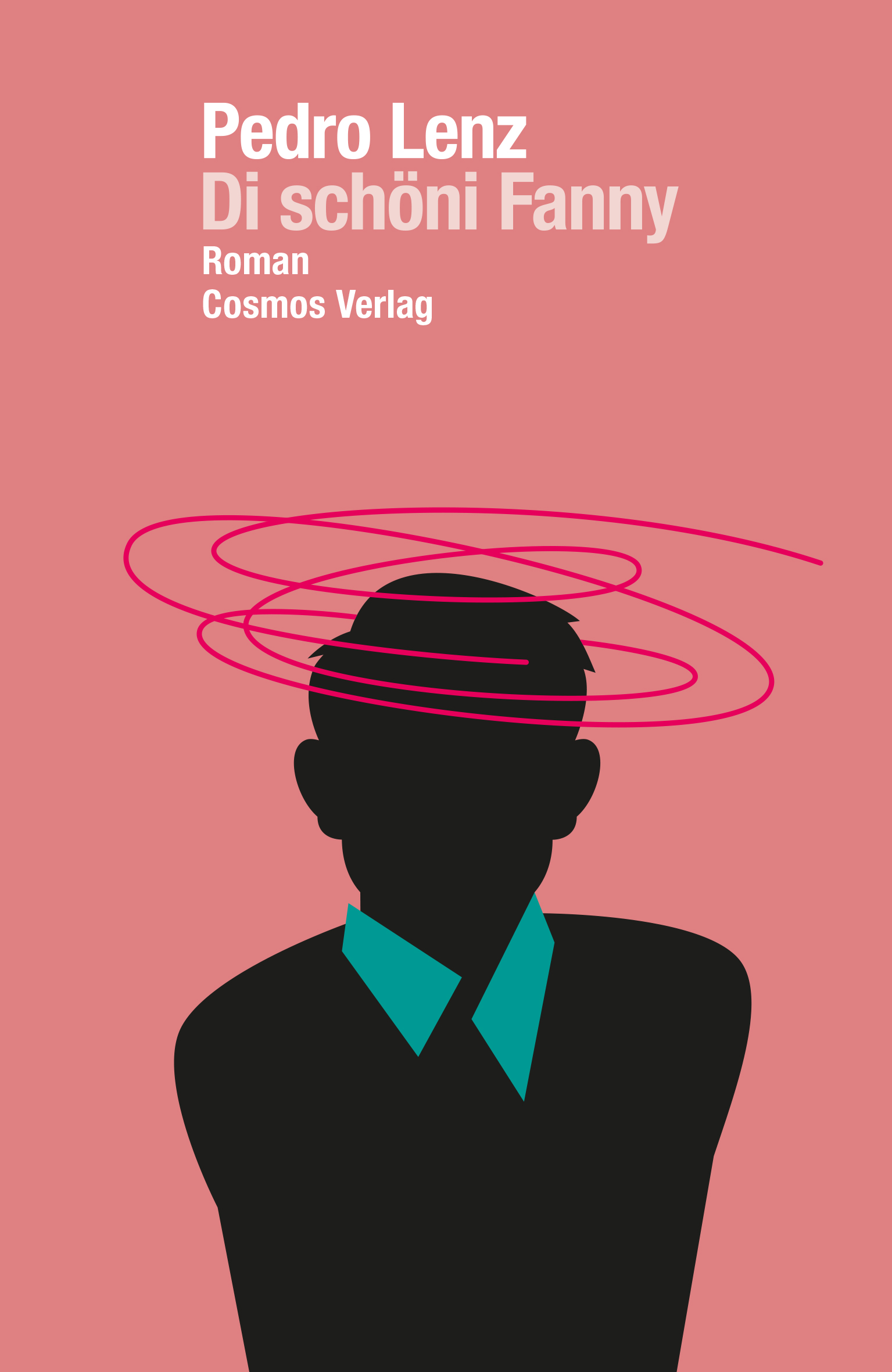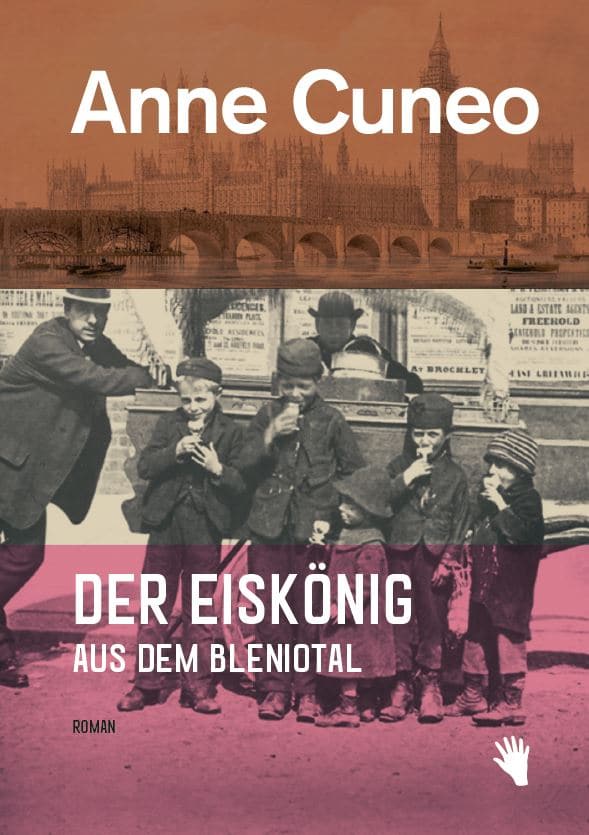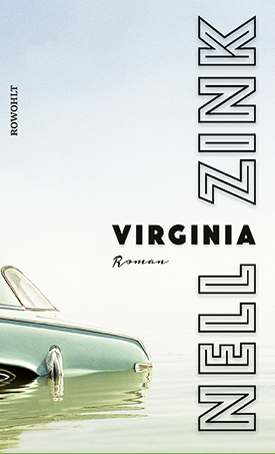Tagebuch
Liebe, Inklusion und PR-Damen: Ein Jahr Feuilletonalltag in Deutschland

Heute beginnt die Buchmesse in Leipzig. Über 3000 Autoren werden an 3200 Veranstaltungen teilnehmen, die an 410 verschiedenen Orten stattfinden. Ich werde dieses Jahr nicht dabei sein. Macht nichts.
12.5.
Michael Wiederstein vom «Literarischen Monat» in Zürich schreibt mir, dass ich mir mit meinem geplanten Artikel über den Literaturbetrieb und seine Korruptionen noch etwas Zeit lassen könne. Ich hoffe, das ist kein Vorwand, um das Vorhaben zu kippen.
17.6.
Ich werde vom C.-H.-Beck-Verlag zu einem Abendessen ins Soho-Haus eingeladen. Das Soho-Haus liegt in Berlin-Mitte, an der Torstrasse, Ecke Prenzlauer Allee, ein achtstöckiger Bau aus den 1920er Jahren, erst Kaufhaus, dann war die HJ drin, dann die SED. Jetzt ist es folgerichtig hip. Ein «schräger Ort», wie ihn Eventmanager lieben. Nun sollen also die Literaturkritiker hier mit dem Herbstprogramm des Verlags bekanntgemacht werden. Die meisten Autoren sind anwesend. Ich schlage die Einladung aus und poste dazu einen Eintrag auf Facebook.
«Einladung ausgeschlagen: a) will man sich nicht korrumpieren lassen und b) sich nicht Rezensionen aufhalsen, die man unter schlechtem Gewissen dann doch nicht schreibt und c) treffe ich Jochen Schmidt doch sowieso ständig hier um die Ecke.»
Das Posting spricht einige meiner Freunde an, aber ich bekomme auch eine E-Mail aus dem Verlag, offenbar hat jemand mitgelesen. Die Frau aus dem Verlag kann nicht verstehen, was an der Veranstaltung und ihrer Einladung falsch sein soll. Sie macht mir ein schlechtes Gewissen. Der C.-H.-Beck-Verlag ist längst nicht der einzige, der sich solche Kritikerbeglückungen einfallen lässt. Es gab auch schon Einladungen zu den Verlegern nach Hause. Was soll man denn davon halten? Und dann erkennt sie ja wirklich nicht, dass eine solche Einladung für korrumpierend gehalten werden kann. Und sie sieht auch nicht ein, dass die Literaturkritik solche Begegnungen eigentlich gar nicht braucht. Dass es völlig reicht, dem Kritiker das Buch zu schicken. Dieses Denken mag der jüngeren Generation fremd sein, aber selbst in meiner Generation teilt ja nicht jeder meine Bedenken. Einer schreibt auf Facebook: «Geh halt hin und schreib dann doch nicht. So macht man das doch.» Aber vollends unverständlich ist mein Verhalten für die Generation Kulturmanagement. Das Soho-Haus ist für sie einfach eine gute Location. Ein Ort, an dem Kritiker und Autoren sich begegnen und ihr gegenseitiges Misstrauen abbauen können. Wir leben im Zeitalter der Kommunikation und der Inklusion. Die Forderung, dass man als Kritiker gewisse Kreise meiden sollte, würden viele wohl für gruppenbezogene Diskriminierung halten.
1.7.
Heute kam mit der Post ein Roman von Bov Bjerg. Auf Anhieb kann man den Titel des Romans nicht erkennen. Der Umschlag ist voller Blurb. Also voll von wohlwollenden Aussagen zum Buch oder zum Autor von bekannten Schriftstellerkollegen und -kolleginnen. Offenbar parodiert das Buch das Verfahren, durch Blurb ein Werk zu bewerben, und bekräftigt gleichzeitig seine Absicht: «Freunde, dieser Autor und dieses Buch haben es nun wirklich verdient!» Und wir machen doch alles mit einem Augenzwinkern. Ich kenne Bov Bjerg nicht persönlich, er ist mir aber als emsiger Autor und Betreiber von Lesebühnen ein Begriff. Diese Lesebühnenautoren und -autorinnen nehmen oft eine sympathisch exzentrische oder doch randständige Haltung zum «Betrieb» ein. Allerdings sind die Lesebühnen – in Berlin zumal! – mittlerweile ein fester Bestandteil des kulturellen Angebots. Manche Autoren kommen nie aus dem Kreis dieser Bühnen hinaus, wollen es wohl auch gar nicht, sehen sich als Produzenten von Gelegenheitstexten. Andere haben ihren festen Platz auch als Romanautoren. Dabei profitieren sie von der «Street Credibility» als Lesebühnenautoren. Nun steigt also auch Bov Bjerg in diesen Kreis auf. Von den Autoren, die seinen neuen Roman auf dem Cover loben, kenne ich ein paar persönlich. Ich bilde mir sogar ein, dass ich mit dem einen oder anderen befreundet bin. Der Kreis schliesst sich. Paradoxerweise hält mich der Blurb davon ab, das Buch zu lesen.
17.7.
Auf «Spiegel online» lese ich die Meldung, dass Rainald Goetz den Büchnerpreis 2015 bekommt. Rasch folgt eine kurze Würdigung des Preisträgers auf der Nachrichtenseite. «Jedes seiner Bücher, selbst die schwächsten, sind von einer so gigantischen Intensität und Sprachkraft und einem Sinn für Sound und Gegenwart und Poesie und Schönheit. Nichts wirkt je ausgedacht, abgelesen, hinterhergeschrieben», schreibt Volker Weidermann über Rainald Goetz. Weidermann ist neu für die Literatur beim «Spiegel» verantwortlich. Ich erinnere mich an seinen Verriss des «Holtrop»-Romans, den er schrieb, als er noch bei der FAS die Literatur verantwortete. Sein Vorgesetzter war Frank Schirrmacher, den Rainald Goetz quasi gefressen hatte. Es war einer von Weidermanns seltenen Verrissen. Lieber lobt er. Volker Weidermann gilt als der grosse Emphatiker der Literaturkritik, der für ein breites Publikum schreibt. Dagegen ist nichts zu sagen, allerdings geraten seine Kritiken oft etwas gar oberflächlich. Ausserdem verwendet er so viele Superlative, dass es mich nervt. Meine kriminelle Energie ist so gross, dass ich den FAS-Artikel aus dem Archiv hole. Ich finde eine Passage, die der obigen diametral entgegensteht. «Währenddessen füllte Goetz mehrere neue Bücher […] mit immer neuen Weltabschreibereien, die von Seite zu Seite immer ermüdender, ichverkrampfter, kleingeistiger, weltloser, böser und erbsenhafter wurden.» Ich stelle die beiden Zitate auf Facebook nebeneinander und schreibe dazu: «Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?»
25.7.
Ich wurde öfter auf mein Posting zu Goetz und Weidermann angesprochen. Ich erfahre zufällig, dass mein Posting in der Redaktion der «Süddeutschen Zeitung» als E-Mail kursiert. Aber ich lese kein böses Wort in der SZ dazu. Die Angelegenheit überschreitet wie die meisten dieser Art die Ebene des Gossip nicht. Dabei könnte daraus eine Diskussion über das Ethos der Kritik erwachsen. «Die literarische Welt» nahm mein Posting immerhin auf und drehte es witzig-postmodern. «Aber vielleicht hat Weidermann, wie es sich für einen erklärten Empathiker gehört, auch einfach nur besonders performativ gehandelt? Hat Goetz die Poetik des Vorläufigen nicht selbst zum Massstab erhoben, als er in ‹Abfall für alle› von ‹einer probierenden, tastenden, aber auch impulsiv explosiven, sich im Zweifelsfall am nächsten Tag korrigierenden, widerrufenden Äusserungsart und Schreibweise› sprach? Vielleicht hat Weidermann Goetz‘ Poetik einfach schon am besten verinnerlicht.» Das ist cool. Da sehe ich mit meiner Häme und meiner schlechten Laune natürlich alt aus.
28.7.
Die neue Macht auf Facebook. Ich erlebe immer öfter, dass jemand meine Freundschaft auf Facebook beantragt und dann erst einmal wie wild meine Postings liked. Nach einer gewissen Zeit schickt mir die Person ein Buch oder eine CD, in der Hoffnung, dass ich sie bespreche oder besprechen lasse. Wenn das nicht geschieht, und das ist meistens der Fall, lassen die Likes schnell nach. Manchmal verschwinden sie ganz, manchmal bleiben sie auf spärlichem Niveau. «Vielleicht tut er ja doch noch was für mich…» Das ist menschlich, und eigentlich möchte ich allen nur Gutes tun. Die meisten, die mir etwas schicken, sind bei einem kleinen Verlag. Sie werden von den grossen Medien gemieden und hoffen, dass es ihnen beim kleinen «Freitag» besser erginge. Das tut es aber nicht immer. Leider. Mir scheint, dass früher in den Literaturbeilagen noch mehr auf die Mischung geachtet wurde: Neben den Werken aus den grossen Verlagen – lies: den wichtigen Anzeigenkunden – stellte man bewusst auch Titel kleiner und unabhängiger Verlage vor. Diese Achtsamkeit ist kleiner geworden. Auch bei uns.
Meine Angst, Menschen zu enttäuschen, ist also gross. Zu gross vermutlich, um ein ganz freier Geist zu werden. Ein ganz freier Geist darf nicht nur keine Angst haben, die Leute zu enttäuschen, er muss auch den Mut haben, Menschen vor den Kopf zu stossen. Das können nur wenige, Marcel Reich-Ranicki hatte wohl die Gabe – unter den Lebenden fällt mir der neue Herausgeber der FAZ ein.
16.9.
Ich soll Ulrich Peltzer mit seinem neuen Roman Ende November im Göttinger Literaturhaus moderieren. Der Roman von Ulrich Peltzer handelt von der Finanzkrise. Die eine Hauptfigur ist ein Sales Manager, der andere ein Investor (unter anderem). Ich werde den Roman erst kurz vor der Veranstaltung selbst lesen, dann bin ich gut vorbereitet. Ich hielt es aber für eine gute Idee, ihn von einem Ökonomen lesen zu lassen. Der Ökonom, der im «Freitag» eine Kolumne hat, las und lieferte eine gepfefferte Kritik. Er fand das Personal klischiert dargestellt. Was tun? Ich organisierte eine positive Kritik, um sie neben den Verriss zu stellen. Ich wusste, dass Ekkehard Knörer das Buch verteidigen würde, und beschrieb ihm offen meine Lage. Er willigte ein. So stehen nun also ein Pro und ein Contra in der Zeitung. Aber was mache ich mit der Moderation? Ich habe Angst, dass mir der Roman nicht gefallen wird. Es muss mir irgendwie gelingen, das Gespräch auf ein so hohes Niveau zu bringen, dass sich eine gewisse Kritik wie von selbst einstellt. Schlechtes Gewissen macht kreativ. Aber, wer weiss, vielleicht werde ich ja überrascht, und mir gefällt das Buch.
20.9.
Mini Minima Moralia: die mündliche Anrede «Mein Lieber» ist im Kulturbetrieb verbreitet. Leider wird sie auch von Menschen gebraucht, die ich wirklich sehr schätze. Sie täuscht Herzlichkeit vor, wo doch nur Beliebigkeit ist. Von der raffinierten, die tödliche Umarmung des Kritikers anzeigenden Verwendung bei Marcel Reich-Ranicki (schon wieder er!) ist nichts mehr übrig. «Mein Lieber» ist nur noch ein Symptom des totalvernetzten Betriebs. Einerseits. Andererseits ist die Floskel für Menschen mit einem schlechten Namensgedächtnis (wie ich es habe) auch ein Segen. Minima Pragmatismus.
12.10.
Mittagessen mit Zora del Buono. Sie ist Schweizerin und lebt seit vielen Jahren in Berlin. Wir haben uns länger nicht gesehen, aber wir verstehen uns gut. Sie ist eine echte Lady, mit «Zürischnurre» und Migrationshintergrund, in Bari aufgewachsen. Als ich sie kennenlernte, war sie primär Journalistin, stellvertretende Chefredakteurin bei der Zeitschrift «Mare». Seit ein paar Jahren ist sie vor allem Schriftstellerin. Sie hat eine Novelle geschrieben, die gross in der «Literarischen Welt» besprochen wurde. Auch wir haben sie besprochen. Ich habe der Rezensentin keine Vorgaben gemacht. Aber was hätte ich gemacht, wenn es ein Verriss geworden wäre? Ist es zum Glück nicht geworden. Wie auch? «Gotthard» ist wirklich gut, wie dafür geschaffen, dass Zora damit in der Schweiz gross rauskommt. Aber es passiert: nichts. Gar rein nichts. Keine Lesungen, keine Einladungen zu Literaturfestivals. Zora ist in der Schweiz schlecht vernetzt. Und ihr Verlag offenbar auch.
Sie hat eine Agentin, deren Mann das Literaturfestival auf dem Monte Verità in Ascona organisiert. Die Wege wären also kurz. Ich scherze: «Lass dich doch auf den Monte Verità einladen. Die Agentur wird schon schauen, dass sie ihre Autoren dort unterbringt.»
Ich war selbst zweimal dort. Als Kulturjournalist. Man lässt sich gerne zu diesem Festival einladen, der Ort ist bezaubernd. Dass ich trotzdem nur am Rand über das Festival geschrieben habe, lag daran, dass ich die meisten Veranstaltungen nicht besonders prickelnd fand: Viele Referenten hielten sich nur bedingt an das Thema («Utopie und so weiter»). Was sich der abtretende NZZ-Feuilletonchef Martin Meyer erlaubte, war sogar eine Frechheit. Zunächst referierte er ellenlang über die historische Aufklärung. Es schien, als habe er einen alten Aufsatz aus der Schublade gezogen, einen, den er für einen Volkshochschulkurs geschrieben hatte. Einen ohne Geist und Witz. Ich war entsetzt. Und nicht nur ich. Natürlich wurde über den Auftritt gelästert, allerdings vornehmlich hinter vorgehaltener Hand. Ich las nur eine einzige Kritik an Meyer. Der Artikel stand in der «Basler Zeitung», geschrieben hatte ihn ein engagierter junger Mann. Nichts zu verlieren? Also noch nicht Teil des Betriebs? Auf eine Anstellung bei der NZZ braucht der jedenfalls nicht mehr zu spekulieren. Wir lästern und lassen uns einladen. So ist das.
25.9.
Am Samstag erscheint zum ersten Mal die neue Literaturbeilage des «Spiegels», der «Literatur-Spiegel». Die Branche ist gespannt und voller vorauseilender Häme. Leider kann auch ich mich nicht von dieser Häme lösen. In der Presseerklärung heisst es: «In der ersten Ausgabe schreibt der US-Schriftsteller Jonathan Franzen über das Erzählen im digitalen Zeitalter. SPIEGEL-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer widmet sich in einer Rezension den Medienromanen ‹Unschuld› von Jonathan Franzen und ‹Nullnummer› von Umberto Eco.» Dass man den Essay eines Autors druckt, dessen Roman man in derselben Ausgabe «rezensiert» (respektive vice versa), ist mir so noch nicht untergekommen. Brinkbäumer wird den Franzen-Roman in seiner «Rezension» bestimmt nicht besonders hart kritisieren. Wie sähe das auch aus?
27.9.
Tatsächlich findet Brinkbäumer nur gute Worte für den Roman von Franzen. Dafür kritisiert er Eco harsch. So funktioniert unser Ablasshandel.
12.10.
Frankfurter Buchmesse. Klett-Cotta lädt Kritiker zum Abendessen ins Literaturhaus. Der Programmchef Tom Kraushaar hält eine charmante, selbstironische Rede. Er spricht davon, dass sich immer die gleichen Nasen zu diesem Empfang einfänden. Aber es gibt Nuancen. «Bis morgen bei Suhrkamp», sagt jemand zu mir. Ich muss kurz überlegen. Klar, der Kritikerempfang bei Suhrkamp. Ich bin nicht eingeladen. Es versetzt mir einen kleinen Stich. Ich habe viel für Suhrkamp getan. Hat nichts genützt. Der «Freitag» ist nicht wichtig genug, ich als Kritiker bin nicht profiliert genug. Oder lieber: man hat vergessen, mich auf die Liste zu setzen. Einerseits bin ich gekränkt, andererseits auch ganz froh. Sich als Aussenseiter im Literaturbetrieb zu fühlen, ist ein wohliges Gefühl. Paradoxerweise fühlt sich ja fast jeder in diesem Betrieb als Aussenseiter. Er kann noch so etabliert und integriert sein. Unser Narzissmus ist beträchtlich.
13.10.
Ich habe nicht viel zu tun auf der Messe. Der «Freitag» muss sparen und hat keinen Stand mehr. Man sollte nicht auf die Messe, wenn man nichts zu tun hat. Weitgehend beschäftigungslos unter so vielen geschäftigen (oder geschäftig umherirrenden) Menschen zu sein, macht depressiv. Das trübe Wetter tut das seine. Um das Schlimmste zu verhindern, frage ich den Journalisten Arno Frank, ob er Zeit für ein Treffen habe. Arno ist frei, schreibt gelegentlich für uns. Wir schätzen uns, kennen uns aber nicht. Er hat Zeit. Mein Tag ist gerettet. Ich schlendere durch die Hallen. An zwei Ständen laufe ich schneller und mache einen Bogen. Der eine Stand wird von einem linken Schweizer Verlag belegt. Ich habe einmal eine Autorin aus diesem Verlag gefördert. Der Verlag schickte mir ihre Bücher in der Hoffnung, ich würde sie besprechen. Ich tat es noch ein-, zweimal, dann blieben die Bücher liegen. Ich habe ein schlechtes Gewissen.
Ich müsste mehr Treffen vereinbaren, habe aber keine Lust. Müsste mich auch mit wichtigen Leuten treffen. Das müsste von mir ausgehen. Das war schon einmal anders. Als ich Chefredakteur der «Netzeitung» wurde, wurde ich plötzlich für die journalistische Elite interessant. So gab es ein Treffen mit dem Chef des «Zeit-Magazins». Es war ganz witzig, wir hatten beide unsere Freude an einem Film über Hochstapler. Ausserdem wollte sich der Chef des «Zeit-Magazins» über neue Entwicklungen im Online-Bereich erkundigen. Ein weiteres Mittagessen gab es nicht, denn ich war nur sehr kurz Chef der «Netzeitung». Ich finde das nicht schlimm. Mir ist ein instrumentelles Verhältnis in und zu der Branche jedenfalls lieber als geheucheltes Interesse. Was mich viel mehr stört, ist der Wandel des «Zeit-Magazins». Manche Ausgaben dienen einzig dem Zweck, ein schickes Werbeumfeld zu schaffen. Die Ausgabe zur Buchmesse wurde vom Verleger Gerhard Steidl besorgt. Er singt ein Loblied auf Papier und Buch. Schöner kann ein Zweck die Mittel nicht heiligen.
23.11.
Post von Ulrich Peltzer. Er ist verärgert über den Verriss seines Buches im «Freitag». Er schreibt, nicht die Kritik habe ihn geärgert, sondern ihre Art und Weise. Der Kritiker gebe sogar den Inhalt falsch wieder. Mich, der ich so etwas abdrucken liess, will er nicht mehr als Moderator seiner Veranstaltung. Was soll ich tun? Ich bin nun selbst verärgert über Peltzer und habe ein schlechtes Gewissen gegenüber der Veranstalterin. Ich überlege, wer an meiner statt Zeit haben könnte. Mir fällt der Kritiker der Pro-Rezension ein. Er kann es einrichten. Er wird nun moderieren. Immerhin: das Buch brauche ich nicht mehr zu lesen.
11.12.
Eine neue Folge des «Literarischen Quartetts» im ZDF. Die Sendung gefällt mir. Die Diskussion ist lebendig, das liegt vor allem auch am Gast: Daniel Cohn-Bendit. Und ich bin ein bisschen verliebt in Maxim Biller. Auch mit Weidermann habe ich in dieser Sendung meinen Frieden geschlossen. Er moderiert kaum. Ich denke über den Neid nach. Natürlich macht mich sein Erfolg neidisch. Ich finde nun einmal, dass es bessere Kritiker gibt. Julia Encke zum Beispiel. Weidermanns Buch «Ostende» fand ich vor allem kitschig. Aber es verkaufte sich eben prächtig. Neid ist in unserer Branche weitverbreitet. Darüber sprechen schwierig. Ich finde ihn allerdings besser als sein Ruf. Solange er einen nicht zerfrisst, ist er ein ganz gutes Antriebsmittel. Ohne Neid wären viele phantastische literarische Werke nicht geschrieben worden.
Das «Literarische Quartett» bespricht auch Bov Bjergs Roman vom Sommer: «Auerhaus». Etwas spät, oder? Alle vier schwärmen davon. Es geht um eine Art betreutes Wohnen, um eine Schüler-WG, in deren Mitte ein selbstmordgefährdeter Halbwüchsiger ist. Seine Freunde wollen ihn am Leben halten. Es gibt ein Geheimnis in diesem Haus, einen Raum ohne Fenster. Christine Westermann bittet Maxim Biller, das Geheimnis nicht zu verraten. Er tut es natürlich doch. Der Kindskopf.
15.12.
«Auerhaus» gelesen. Ein wunderbares Buch. Der Blurb auf seinem Umschlag sagt die Wahrheit.
Michael Angele
ist deutsch-schweizerischer Journalist und Literaturwissenschafter. Er ist stellvertretender Chefredaktor und Kulturchef des deutschen Wochenmagazins «Freitag». Angele lebt in Berlin.