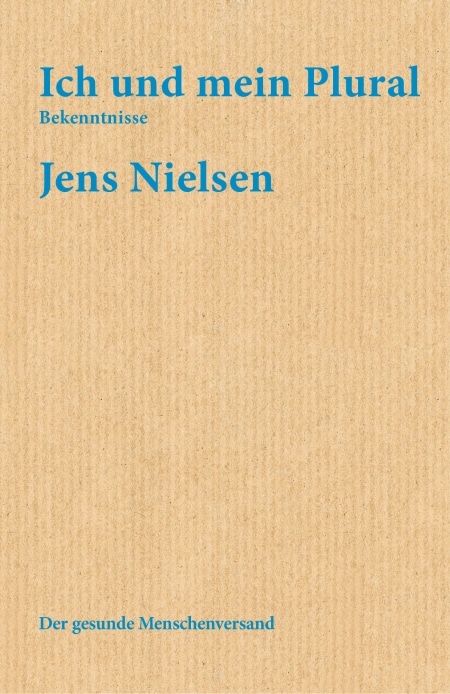Auszüge aus dem unveröffentlichten Roman «Les Monarques»
Wie «Béton armé» besteht das Buch aus zwei Teilen, deren Handlung in Tel Aviv und Kairo sowie im Paris der 1930 Jahre spielt.

In Memoriam Guido Leotta
Wenn ich vor die Götter des Alten Ägyptens treten müsste, die das Herz eines Menschen auf die Waagschale legen, dann würde ich ihnen eine Geschichte erzählen. Es ist Sommer. Ich liege auf einem Liegestuhl im Hof. Meine operierten Beine schmerzen. Auf der anderen Seite der Hortensienhecke bringen Bauern ihre Milch ins Milchgeschäft. Ihre Stimmen werden vom Lärm der leeren Kannen, die man auf die Wagen wirft, übertönt. Ich richte mich auf, um besser zu hören. Die Metallklammern in meinen Knochen schneiden mir ins Fleisch. Ich falle zurück. Diese selbstsicheren Männer sind mir zuwider. Ich hasse ihre Stärke. Ihre Eitelkeit. Ich möchte sie kriechen sehen, so wie ich seit Anbeginn krieche. Dann beruhige ich mich. Die Sonne scheint. Es gibt keine Stärke oder Schwäche mehr, weder Wut noch Trauer.
Als ich das Zimmer meines Vaters verliess, steckte ich die kleine Pelikan-Figur ein. Das Bestattungsinstitut rief an. Ihr Auto kam wegen des Schnees nicht weiter. Man würde den Toten erst am nächsten Tag abholen können. Ich ging in mein Zimmer zurück und stellte den Pelikan auf meinen Nachttisch. Auf dem Rücken liegend vertiefte ich mich in die Betrachtung der Feuchtigkeitsflecken an der Decke, in ihre bizarre Weltkarte. Ein riesiges Russland erdrückte ein verkümmertes Europa. Die Uhr der Dorfkirche schlug. Verwirrt, weil ich keinerlei Kummer verspürte, ging ich zu meinem Vater zurück. Sein Bett wurde vom Mond beschienen. Ich machte kein Licht. Ein bitterer und süsser Geruch. Neutrales Licht, absolute Stille. Und Adly, so präsent, plötzlich mit übernatürlichen Kräften begabt, kann unter den geschlossenen Lidern sehen, mit aufeinandergepressten Lippen sprechen. In der gleichen Ewigkeit gefangen öffne ich ein Fenster, nehme das Handtuch mit den Hasenohren weg, bevor ich mich auf die Bettkante setze und eine Hand auf die meines Vaters lege. Eine Wolke schiebt sich über den Mond, wirft einen Schatten auf den Toten, der sich zu regen scheint.
Sein Gesicht erhellt sich, während er zu sagen versucht, was er alleine sehen kann. Er starrt auf die Mauer vor ihm. Er nennt den Namen seiner Eltern, seiner Grosseltern und ihrer Eltern, und immer weiter zurück geht er in der Generationenabfolge bis sich diese seltsame, mit schriller, von Schluckauf unterbrochener Stimme vorgetragene Litanei schliesslich in tiefen Lagen bricht, einen tierischen Ton bekommt. Er faucht, knurrt, sein Französisch verwittert, löst sich in Fetzen ab wie der Verputz einer alten Mauer, legt arabische, pharaonische, mineralische Klänge frei. Seine Stimme wird noch tiefer, taucht in den Ursprung. Ein fernes Grollen, Höhlenwispern, er spricht die Sprache der Menschenaffen, der Bäume und der Sonne. Ich sehe ihn an. Ich denke an jene tibetanischen Kinder, die mit einem Lächeln voll glücklicher Melancholie zur Welt kommen, das sie von der Wiege bis zur Bahre nicht mehr ablegen. Ob sie Lama werden oder Stallbursche bleiben, sie leben im Einklang mit den tiefen Tälern, den eisigen Wipfeln des Himalaya und breiten ihre Seele aus wie ein Segel. Sie schweben mit den Adlern. Sie kreuzen zwischen den Welten, in Rauch gehüllt, mit den himmlischen Luftspiegelungen, die sich an den Landzungen der Kontinente bilden. Eines dieser Wesen ruht vor mir, in einem Bauernhof des Plateau de Vaud. Adieu, Vater. Vielleicht hast du heute eine Antwort auf die Frage, die ich dir einmal stellte, als ich von der Schule nach Hause kam, weisst du, dass es in Indien einen Mann gibt, der die Seelen operieren kann? Du lachtest höhnisch und fragtest mich, wer mir solchen Unsinn erzählt hätte. Nun weisst du, ob es einen solchen Weisen gibt, ob er, wie ich behauptete, auf einem Spitalboot lebt, das am höchsten Hafen der Welt, mit Namen Alappuzha Guruvayoor, vertäut ist, so hoch oben in den Bergen, dass die Schiffe ihn auf dem Luftweg anlaufen.
Aus meinem Wachtraum erwachend schloss ich das Fenster und zündete eine Lampe an. Der Tote lag zusammengekauert in seinen Schatten: Ein Ding, das niemals lebendig gewesen zu sein schien. Meine Mutter würde noch lange nicht zu mir kommen, und ich würde zuerst die Türe ihres Zimmers, das sie durchqueren musste, knarren hören, bevor sie einen weiteren Türflügel aufstiesse, um hierher zu gelangen. Ich umrundete das Bett und ging zum Schrank, von einem unbekannten Machtgefühl erfüllt. Ich war alleine in diesem Zimmer, alleine auf dem Stock, nunmehr einziger Mann der Familie. Ich öffnete den Schrank. Sein Anzug. Drei Hemden. Ein Schlafrock. Mehrere blaue Arbeitsoveralls, dicke Wollpullover, Cordhosen. Auf dem Boden Schuhe und Sandalen, sowie ein grosser, weisslicher, robuster Plastiksack, mit einem Eisendraht verschlossen. Ich nahm ihn aus dem Schrank, und nachdem ich das verschlungene Drahtstück entfernt hatte, schüttete ich den Inhalt auf die Wolldecke, zwischen dem linken Bein des Toten und der Bettkante. Eine Lawine von Frauenstrümpfen, in allen Grössen und Farben, in Pastell oder leuchtenden Tönen, Seidenstrümpfe mit Naht, elastische Nylonstrümpfe, aber kein einziges zusammengehörendes Paar fand sich in dieser bunten, duftenden Krake von etwa hundert ganz im Geheimen gesammelten Trophäen. Durch das Fenster erstreckte der Jura seine kobaltblaue Masse. Die metallene Wirbelsäule der Hochspannungsleitung verlor sich am Horizont. So wenige Worte, um die vertraute Schönheit zu benennen, um den Willen des Vaters zu übersetzen, der nur noch von weit weg zu mir sprach. Manche Strümpfe waren mit Goldfäden durchwirkt, mit Spitzen besetzt. Auf anderen öffnete sich eine Naht wie ein Auge beim Ansatz der Schenkel und oberhalb der Ferse. Die meisten hatten eine Laufmasche. Ich verbrachte eine, vielleicht zwei Stunden inmitten dieser Frauenfetzen. Als die Eingangstür zuklappte, stopfte ich das Ganze wieder in den Beutel und diesen in einen Abfalleimer der Gerätekammer. Diese Seite im Leben meines Vaters hat es nie gegeben. So habe ich begonnen, seine Geschichte neu zu erfinden. Zuunterst in der Tüte lag auch eine Fotografie. Einziges Gesicht in diesem Museum des anonymen Begehrens, das Bild einer Frau mit hellen Haaren und Augen. Sie posierte im Dreiviertelprofil, in einem Reitkostüm auf einem Kamelsattel sitzend. Auf die Rückseite hatte mein Vater geschrieben: «Mama, Kairo, 1913?»
Ausgezeichnetes Werk: «Allegra». Paris, Editions La Table Ronde, 2016.