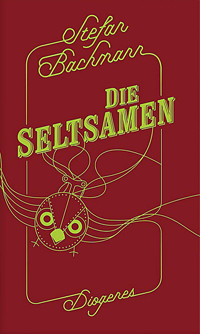Der feine Herr Kracht
Christian Kracht ist einer, von dem man nie weiss, wo er ist. Von dem man bloss ahnt, dass er irgendwo sein muss. Sein Verschwinden war lang geplant, wird aber medial noch immer nicht akzeptiert. Ein Treffen mit dem Schweizer Buchpreisträger in Zürich.
«Willkommen in meinem Schrank!», sagt er, als ich an einem Spätsommertag die «Kronenhalle»-Bar betrete, hebt grüssend seine Flasche Rivella, zupft mit der anderen Hand am neuen, wohlgepflegten Rauschebart – darunter, fast versteckt: ein warmes Lächeln.
Eigentlich wollte ich Christian Kracht in Los Angeles besuchen, nicht an dieser Haarnadelkurve mit Aussicht, sondern daheim, er hätte mich sogar reingelassen, sagte er am Telefon, dann aber kam – wie immer – viel dazwischen. Vor zwei Tagen nun ein Anruf, er sei in Zürich, ob wir uns hier treffen wollten, klar. Kracht, 1966 in Saanen geboren, zählte diese Bar einst zu den «angenehmsten der Welt». Er wird Ende Dezember fünfzig, gleichwohl strahlt er unter der Kutte des dezidiert Bürgerlichen, die er sich in den letzten Jahren mindestens für die wenigen Medienauftritte übergeworfen hat, eine alterslose Verwegenheit aus. Er könnte im Nebenamt auch Nachtportier in einer Joseph-Roth-Geschichte, protestantischer Pfarrer im Berner Oberland oder ein britischer Agent mit nostalgisch-parodistischer Ader sein. Oder Filmregisseur? Kracht holt gesalzene Mandeln an der Bar, lockert den Schal, winkt dabei ab. Film, das habe er studiert. Sicher, er habe immer Regisseur werden wollen, aber auch stets gewusst, dass er dazu eigentlich nicht tauge. Deshalb habe er ja auch seine Frau, die Regisseurin Frauke Finsterwalder, geheiratet. Die hätte stets Schriftstellerin werden wollen, so ergänze man sich doch wunderbar. Das hat er auch Denis Scheck gesagt, als der ihn in Los Angeles in besagter Kurve interviewte, ein fröhliches Trauerspiel. Er selbst sei, ergänzt Kracht beim Griff ins Mandelglas, viel zu tyrannisch für den Regiestuhl: Elf Drehbücher zu «Faserland» habe er schon abgelehnt, der «Imperium»-Film hingegen – er überlegt – nehme wohl doch noch Form an.
Christian Kracht gibt selten Interviews, aber noch seltener gibt er in Interviews Antworten, von denen wir Journalisten guten Gewissens behaupten könnten, sie seien brauchbar.
Imperium. Eine Besprechung dieses, seines letzten Romans im «Spiegel» hatte 2012 zum Eklat geführt, vor allem weil ihrem Autor Georg Diez die Haltung von Krachts Erzähler in bezug auf dessen Erzählgegenstand, den teilfiktiven Werdegang eines deutschen Lebensreformers und Kokosnusspredigers zu Beginn des letzten Jahrhunderts, vor allem dessen sich ausprägender Hang zum Totalitären, missfiel und er nicht gewillt war, Autor und Erzähler an dieser Stelle sauber auseinanderzuhalten. Kracht sagte dazu: nichts. Er fuhr stattdessen mit Scheck Fahrrad, auch das sehr fröhlich, und lag mit all dem Schweigen wohl keineswegs falsch. Schliesslich gehört der Hinweis auf die strikte Trennung von Autor und Erzähler im Fach Deutsch genauso zum Oberstufenstoff wie die Lektüre seines Erstlings «Faserland». Weniger fröhlich: auch in den Schweizer Feuilletons blieb es damals bemerkenswert ruhig. Vielleicht, weil man Kracht hierzulande weiterhin für einen «Deutschen mit Schweizer Pass» (NZZ) hält? Vielleicht, weil sich niemand mit Unterstützung für den «Falschen» die Finger schmutzig machen wollte?
Was ist Christian Kracht?
Der Autor putzt seine Brille. Er sei froh, dass er in Los Angeles vom hiesigen Kritikerzirkus nur noch wenig mitbekomme, sagt er. In Kalifornien sei er zum Glück weit weg, und diese neue Unabhängigkeit mache ihn gelassener. Als «Imperium» vor rund einem Jahr in englischer Übersetzung erschien, wurde das Buch sehr positiv rezensiert. Niemand kam auf die Idee, Kracht für einen Apologeten des nägelkauenden Kokosfaschismus zu halten. An Metadiskussionen hatte Kracht noch nie Interesse, an der Einordnung des eigenen Werks oder der eigenen Person schon gar nicht. Ganz anders der Literaturbetrieb: erst im Oktober fand an der Universität Bern eine Tagung mit dem Titel «Wer oder was ist eigentlich ‹Christian Kracht›?» statt. Die Frage könnte aktueller kaum sein, sie ist vor allem treffend formuliert und ruft förmlich: der Name dieses Autors ist zur entpersonalisierten Folie geworden, wenn der Autor nicht will, so nimmt die Zuschreibungsindustrie eben die Feder in die Hand. Was ist Christian Kracht? Das suggeriert: eine Masche? Ein Kunstprodukt? Gar Zentrum eines Kultes, wie der «Tages-Anzeiger» jüngst insinuierte?
Immer wenn Christian Kracht nichts sagt oder vielleicht meint, etwas gesagt zu haben, schaut er dich, in Erwartung einer nächsten Frage wohl, eindringlich an. Wenn du zurückschaust, werden seine Augen grösser und grösser, irgendwann lächelt er vielleicht. Auf den ersten Blick mag die betonte Kühle und fast rituell gepflegte Unnahbarkeit des Autors also tatsächlich befremdlich oder aufgesetzt wirken. Es ist vielleicht aber auch das Los tatsächlich originärer Schriftsteller, beim nach für den gewählten Kontext möglichst aufschlussreichen Antworten suchenden, stets «ans Publikum» denkenden Journalisten für Schweissausbrüche zu sorgen. Alle Kollegen, die ich nach der eigenen Erfahrung bei der Moderation eines Gesprächs mit dem Schriftsteller befragte, winkten ab. Viele sprachen von «Katastrophen», manche von «Herausforderungen», einige schüttelten bloss den Kopf.
Christian Kracht gibt selten Interviews, aber noch seltener gibt er in Interviews Antworten, von denen wir Journalisten guten Gewissens behaupten könnten, sie seien brauchbar. In Ascona machte 2012 das Gerücht die Runde, er wolle ein dort zum Verkauf stehendes Antiquariat übernehmen, ein Podiums-gespräch auf dem Monte Verità war dahingehend angekündigt, ich sollte moderieren. Es dauerte keine fünf Minuten, da hatte er den Saal gegen sich aufgebracht, weil er offen zugab, dass ein Spaziergang durch Ascona ihn davon überzeugt hätte, dass er hier sicher nicht investieren werde. Ascona sei schrecklich, er werde überdies das Gefühl nicht los, dass man ihn über den Tisch ziehen wolle*. In der ersten Reihe fiel Hans Magnus Enzensberger vor Lachen fast vom Stuhl, weiter hinten fielen nur die Kinnladen. Beim Ausgang gab es Gerangel, eine Menschentraube, Unverständnis, Unbefriedigung. Auch wenn Krachts Antworten dann einmal befriedigend scheinen, so sind sie doch nie kontextuell ausformuliert, nie verpackt in Anschlussfähiges, wie man das von anderen Grossschriftstellern gewohnt ist. Stattdessen: eine Lust am Scheitern, an der Verweigerung – und zwar nicht nur durch seinen medialen Rückzug, sondern besonders dann, wenn er sich scheinbar zur Verfügung stellt.
Genau besehen ist Christian Kracht zunächst also das Gegenteil des in den Leitmedien so beliebten Public Intellectual. Sein koordinierter Rückzug – räumlich von der Schweiz über Berlin, Neu-Delhi, Bangkok, Kathmandu, San Francisco und Florenz nach Los Angeles; medial von der Produktion avantgardistischer Zeitschriften über das Verfassen von Kolumnen für Leitmedien bis hin zum völligen journalistischen Schweigen oder Verwirbeln – steht dabei in starkem Kontrast zum grellen Me-dienphänomen, das Kracht noch in den 1990er Jahren war. Damals posierte er mit auf den Betrachter gerichtetem Pistolenlauf für Pressephotos, gab das Avantgarde-Literaturmagazin «Der Freund» von Nepal aus heraus und zeigte sich gern öffentlich. Heute sind seine Auftritte rar, wenn auch wieder zahlreicher als vor wenigen Jahren, aber sicher anders. Der «ehemalige» Kracht allerdings ist die klar bestimmende Grösse für die meisten journalistischen Annäherungsversuche. Kracht wird weiterhin reflexartig dem «Pop» zugeschrieben, der «Dandy» als sein Role-Model identifiziert, die spärlichen Informationen aus der Vita des Schriftstellers mit seinem Werk abgeglichen, seine Vorlieben mit denen seiner Figuren. Wer die Konjunktur der Verschränkung zwischen Autor und Erzähler (nicht nur beim «Spiegel», auch in der Germanistik) in der Causa Kracht verfolgt, wundert sich also kaum darüber, dass ein vom Interpretationsbetrieb selbst kreiertes Autorenkunstprodukt nun, siehe Bern, einer erneuten Metainterpretation unterzogen werden muss.
Wenn gegenwärtig von Christian Kracht die Rede ist, so ist damit vor allem sein medial «eingeschweisster» Schatten aus den 1990ern gemeint. Die Person dahinter, der Herr, der sich doch verändert haben muss, mir nun gerade erzählt, dass er gebeten wurde, einen Text für den diesjährigen Manifesta-Katalog zu schreiben (das aber ablehnte, womit der ewige Houellebecq übernahm), und warum er das ängstliche Europa nicht verstünde und an welche Orte er reiste, um seinen neuen Roman «Die Toten» zu schreiben (Kyoto, Los Angeles, Irland), ist derweil einfach aus dem Diskurs verschwunden. Vielleicht, weil er auf den Betrieb, die ganzen Spekulationen und das Posieren wirklich keine Lust mehr hatte? Kracht schweigt. Ob ich Benjamin von Stuckrad-Barres «Panikherz» schon gelesen hätte, fragt er dann. Ich muss verneinen, stelle aber später bei der Lektüre fest, dass das eine Antwort ist, keine Frage. Stuckrad-Barres jüngstes Buch schildert eindrücklich den Umgang der Me-dien mit im Rampenlicht stehenden Starschriftstellern: «Der Künstler hat – bitte schön – eine Jukebox zu sein.» Stuckrad-Barres Karriere führte seit «Tristesse Royale», als er mit Kracht und anderen im Berliner «Adlon» über Status, Distinktion und Öffentlichkeit plauderte, in einen so persönlichen wie multimedialen Abgrund: alles für den Auftritt, alles fürs Blitzlicht, Pop!, Rock’n’Roll, Ironie, Pose, Kaputtmachen, Weiterziehen, vielleicht noch Pet Shop Boys. Und wenn jemand nicht mehr mitspielen konnte oder wollte: auch egal. Zug verpasst, abgefahren. «Irgendwie hatten uns alle hängenlassen», schrieb er jüngst. Kracht dagegen hatte schon damals sein bewusstes Verschwinden angekündigt, in Interviews und Texten, spätestens zwischen 2012 und Anfang 2014 war er für die Öffentlichkeit tatsächlich nicht mehr auffindbar. Er wurde dann unhinterfragt als politisch randständig, dekadent, snobistisch, kindisch oder schlicht bescheuert bezeichnet, die Nazikeule war nur die Spitze des Eisbergs. Ein Trost: so töricht ging man hierzulande stets nur mit den Grossen um.
Was schreibt Christian Kracht?
Seit Jahren arbeitet dieser Autor nun unter Einhaltung einiger weniger medienökonomischer Grundsätze in enormer Zurückgezogenheit an einem Werk, das mit seinen Erstlingen kaum etwas gemein hat. Spätestens seit 2008 hat er sich der Form der «historiographischen Metafiktion», wie er – die -Germanistik zitierend – mitteilt, verschrieben, also der Fort- oder Umschreibung historischer Begebenheiten. Immer wieder stosse er auf sogenannte «Nuggets», wahre, in der Rückschau vielleicht skurrile – oder den Lauf der Welt auf ihre Art «vorwegnehmende» – Geschichten, die kaum jemand mehr erinnere. Irgendwann sei er auf das gescheiterte Attentat auf Charlie Chaplin in Tokio gestossen, und diese Entdeckung habe am Anfang von «Die Toten» gestanden.
Der Mordversuch hat tatsächlich stattgefunden, Kracht allerdings verbiegt im Roman die historischen Details, ergeht sich in Chaplins Freude am japanischen No-Theater, seinen drei sich steigernden Akten jo-ha-kiū, die, wie wir später in den Rezensionen lesen werden, die Blaupause für Krachts Buch sein sollen. Vielleicht, so Kracht, als er sich nachdenklich in unserer Barnische zurücklehnt, schreibe er ja auch an einer neuen Trilogie, einem neuen «Triptychon». Und da ist sie schon wieder, die angebotene Verschränkung von Autoren- und Werkbiographie, die ausgestreuten Brosamen für die biographische Schnitzeljagd der Krachtinterpretation. Der Autor kneift, auf das doch hiermit schon wieder angestossene interpretatorische Ausschlachten seiner historischen Verbiegungen im jüngeren Werk angesprochen, die Augen zusammen, schüttelt mit dem Kopf. Das sei doch eben das Wesen der Geschichte, meint er, das «Als ob» und das «Wenn nicht..?», und macht eine ausladende Handbewegung, die unmöglich klarmachen kann, was unklar bleiben soll. Da stehst du also wieder, denkst dar-über nach, was zuerst da war: das Huhn oder das Ei? Ist sein literarisches Spiel mit der Andeutung, seine gross angelegte, ästhetisierte «Übertreibung in Richtung Wahrheit» (Günther Anders), sein distinguiertes Kalauern doch nicht ganz unschuldig daran, dass ihm selbst eine gewisse Künstlichkeit, Ästhetisierung, ja Maskenspiele -unterstellt werden – oder ist es andersherum: kann man «Die -Toten» eigentlich wirklich lesen, wenn man nicht weiss, wer (oder was) Christian Kracht ist?
Wer ihm aufmerksam zuschaut und zuhört, auch jetzt gerade, hört und sieht keine permanente Veränderung, kein Maskenspiel, sondern sehr oft more of the same. Es gehe ihm auch in «Die Toten» wieder um das Böse, sagt er, das sei ja offensichtlich, bestellt noch ein «Rivella rot» und ergänzt Sätze, die er mir bereits zur Premiere von «Finsterworld» im Jahr 2013 mitgab: Darum, wie es in die Welt komme, was es anrichte, in welchen Gestalten es sich zeige. Ähnlich wie in «Imperium», wo diese doch zunächst recht banal klingende Intention – verdeutlicht am zum Totalitären neigenden Romantizismus der Deutschen – auch schon überdeutlich war, haben wir es in «Die Toten» wieder mit Motiven von Tradition, Avantgarde und Reaktion zu tun, eine Art Leib-und-Magen-Thema Krachts schon seit «1979», allerdings heute weniger subtil konterkariert, viel aufgeblasener, offensichtlicher, dabei hohler, schrecklicher, ja lächerlich. Das, so Kracht, als er sich langsam wieder vorlehnt, sei doch der einzige Weg, dem Bösen angemessen zu begegnen: darüber lachen.
Ein Autor verschwindet
Christian Kracht wirkt gelöster als in den Vorjahren, entspannter, ruhiger. Seine freundliche Authentizität beim Wiederholen von Floskeln, Bildern und Binsen, die nicht zuletzt ganz ehrliche Antworten auf immer gleiche, oft sehr dumme Fragen von uns Journalisten («Jukebox») sind, ist dabei auf so wunderbare Art versöhnlich, ja wohltuend ehrlich im eher überkonstruierten Literaturbetrieb, dass man dem Autor dafür dankbar sein darf. Er, der konsequent den Weg geht, den er schon in seinen grelleren Jahren skizzierte – das «Verschwinden hin zum Nullpunkt» als Gegenentwurf zum immerwährenden «Re-Modeling» bekannter Celebrities, auch und immer mehr aus den Reihen der Literaten –, ist als Person hinter und neben sein mediales Abziehbildchen getreten und vielleicht genau deshalb der einzige, der als Schriftsteller die Pop-Ära überlebte. Tom Kummer spielt heute vorwiegend Tennis. Marc -Fischer stürzte sich in den Tod. Eckhart Nickel arbeitet, so höre ich, am Frankfurter Flughafen. Und Benjamin von Stuckrad-Barre, genau, fand gerade noch rechtzeitig zurück zu Udo Lindenberg. Der Autor lacht, als ich ihn frage, was er gerade lese. «The Age of Wire and String» von Ben Marcus, halb Handbuch, halb Fiktion – und demselben literarischen Prinzip verhaftet: Gegenstände vom Schrotthaufen der Geschichte erhalten einen neuen Platz in einer neuen Realität. Und wenn Kracht so lacht, sich den Rivellaschaum aus dem Bart putzt, ist doch sonnenklar: Christian Kracht ist eben keine Rolle, kein Label, keine Kunstfigur, kein Witz seines Verlegers – der Mann ist schlicht ein zuvorkommender, im eigentlichen Sinne feiner Herr, dessen Literatur entweder begeistert oder verstört. Eine diskursive Herausforderung für Journalisten, sicher, ein guter Grund zum journalistischen Scheitern, stets, aber eine persönlich wie intellektuell gleichsam erheiternde, aufbauende Persönlichkeit.
Am Ende stehen wir rauchend vor der «Kronenhalle»-Bar, wieder einmal gescheit gescheitert – und zufrieden. Zwischen den letzten zwei Zügen frage ich ihn, welche «Nuggets» ihn wohl zu seinen Protagonisten Nägeli und Amakasu in «Die -Toten» geführt hätten. Kracht, gelehnt an die Fassade, eine lange blonde Strähne hängt in Richtung Trottoir, wendet den Kopf. «Beide sind gewissermassen Christian Kracht», sagt er lächelnd. Und dann haucht er, fast zart, durch den Schrei, den das 15er Tram beim Bremsen macht: «Nichts ist Christian Kracht.» Der Berner Germanistik, denke ich, geht in den kommenden Jahren die Arbeit nicht aus.
* In der Tat waren die Angaben zum Zustand, zum Wert und zu den Pachtbedingungen des Ladenlokals widersprüchlich, wie er mir später anhand einiger zugesandter Papiere zeigte.