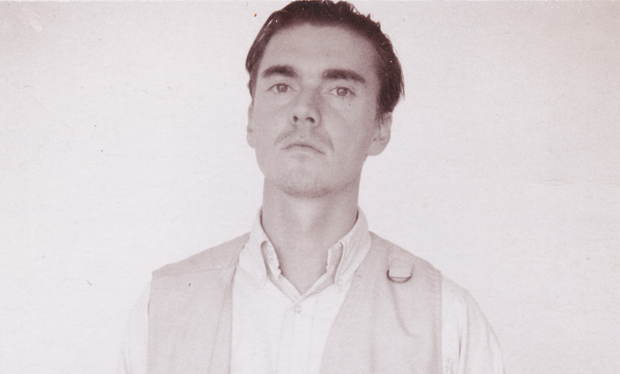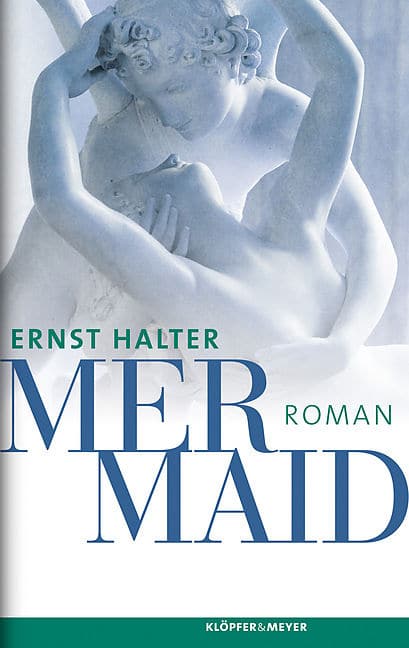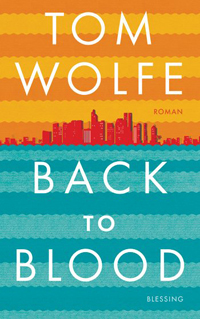Online Spezial: «Welche Wirklichkeit bitte?»
Den Journalismus entheucheln. Das wollte Tom Kummer, als er vor über 20 Jahren als «Tempo»-Reporter begann und die objektiven Dinge der Welt in subjektiver Radikalität darstellte. Heute hat er mit solchen Drehungen nichts mehr am Hut. Transatlantische Korrespondenz mit einem legendären Reporter.

Tom, um über das zentrale Thema dieser Ausgabe – die literarische Reportage; zwischen Fiktion und Realität – zu sprechen, gibt es wahrscheinlich keine geeignetere Person als dich. Bekanntgeworden bist du als Journalist und Reporter beim deutschen Magazin «Tempo», du hast Reportagen verfasst und Interviews mit den Schönen und Reichen geführt. Im Jahr 2000 kam heraus, dass einige dieser Interviews nie stattgefunden haben – du sie quasi erfunden oder aus anderen Quellen zusammengesetzt hast. Seither bist du für viele Journalisten eine Persona non grata – hast aber auch eine beachtliche Schar an Fans. Wie siehst du dich und deine Arbeit heute, bist du eher Schriftsteller oder eher Journalist?
Schreiben ist Leben, Leben ist Schreiben. Das gilt für mich seit den «Tempo»-Zeiten der 80er Jahre. «Tempo» war eine Lebensform, eine Ekstase kreativen Arbeitens in einer Gemeinschaft von prinzipiell Gleichgesinnten. Davon bin ich nie weggekommen. In der Schweiz veröffentliche ich momentan in der «Weltwoche». Da verstehe ich mich eindeutig als Journalist, die «Weltwoche»-Redaktion besteht aus erfahrenen Profis, und die haben mit so was wie der «Tempo»-Schule nichts am Hut.
Vielleicht umreisst du diese «Tempo»-Schule kurz?
Bei «Tempo», wo ich 1987 als 24jähriger angefangen habe und eine Art Ausbildung durchlief, traf ich auf eine Gruppe junger, deutscher Autoren – Leute wie Maxim Biller, Christian Kracht, Helge Timmerberg und den «Tempo»-Gründer, Markus Peichl, der uns gleich mit seiner These vertraut machte. Sie hiess «Faszination des Fiktiven». Die zugehörige Berufsauffassung geht vom besonderen Verhältnis zwischen Autor und Text aus: der Text ist nicht zu trennen von seinem Verfasser. Ich erinnere mich gut daran: die Zeit war wegweisend und machte es fortan schwer, eine eindeutige Trennung zwischen Schriftstellerei und Journalismus vorzunehmen.
Was brachte Peichl euch bei, das so neu war in der deutschsprachigen Medienlandschaft?
Peichl sagte Dinge wie: «Weil in der Gesellschaft alle Werte entwertet und alle Wahrheiten entwahrheitet sind, muss sich in ‹Tempo› die Grenze der Realität neu erproben lassen.» Wir wollten ideologisches Denken demaskieren. Das hiess: es galt, der Lächerlichkeit des Seriösen zu entkommen, indem man ernsthaft das Sich-nicht-ernst-Nehmen probte, es galt, die Fiktionsmechanismen aller Medien offenzulegen, indem man sie augenzwinkernd mit einer radikalen Subjektivität konfrontierte.
Wie sollte das genau gelingen?
Ich glaube, an den Journalistenschulen wird das heute so definiert: Handlungen des Autors werden zum dominierenden Geschehen. Der scheinbar neutrale Beobachter verwandelt sich in den Teilnehmer, er partizipiert an dem Geschehen, das er beschreibt, setzt sich aufs Spiel, identifiziert sich… usw. Interessanterweise wurden wir bei «Tempo» und auch später, als wir zur «SZ» oder zum «Tagi-Magi» wechselten, von den etablierten Journalisten und Literaten gerade darum verachtet, weil sie annahmen, wir würden uns bloss clever selbst vermarkten. Ja, das mag für einige gestimmt haben, ich habe aber nie an Selbstvermarktung gedacht. Vom konservativen Journalismus wurden meine Texte – ich spreche von den Reportagen – natürlich als «Parajournalismus» verdammt, als Journalismus, der mit heiligen Grundsätzen der Branche brach.
Die da wären?
Ausgewogenheit, Objektivität und kritische Distanz. Mit unserer Subjektivität setzten wir auf ein neues Zielpublikum: es war zwischen 20 und 30 Jahre alt, unideologisch, erfolgreich und engagiert, vielleicht ökologisch interessiert, aber ohne festes Weltbild, nirgendwo ganz beheimatet, wir wollten ein Organ der Selbstverständigung für eine «Generation der Widersprüche» sein.
«Tempo» wurde damals von anderen Medien heftig kritisiert und im April 1996 eingestellt, die entstehende, ähnlich gelagerte Konkurrenz hatte dem Magazin schwer zugesetzt.
Ja, das Echo der Mainstreammedien war damals gewaltig – und in der Regel negativ, wie heute beim Online-Journalismus: «Tempo» galt als affirmativ, man predige «die Beliebigkeit», schrieb der «Spiegel», bei dem dann recht bald ein halbes Dutzend «Tempo»-Autoren unter Vertrag standen. «Tempo» predige den Konsum, hiess es auch, «Tempo» sei unpolitisch, infantil und einfach dumm. «Tempo»-Autoren würden künstliche Trends produzieren, predigten nur den Schein und nicht die Wirklichkeit. Welche Wirklichkeit bitte, haben wir uns damals gefragt. Jede Zeitschrift produziert Scheinwelten und Scheinwirklichkeiten. Schon in den 90ern hat doch niemand mehr ernsthaft geglaubt, dass es nur eine einzige Wirklichkeit gibt.
Du wärst – glaube ich – überrascht, wie viele Leute bis heute an eine einzige Wirklichkeit glauben. Viele Zeitungen und Zeitschriften haben ihren Stil auch dementsprechend angepasst: es dominiert eine Art objektivierte Schreibe, die vorgibt, reine, nüchterne, sachliche Informationen, kurz: Wahrheit zu vermitteln – Meinung hingegen wird klar als solche deklariert.
Meine Kollegen und ich glaubten immer, dass extreme Subjektivität ehrlicher sei. Der traditionelle Journalismus dagegen beharrt, da hast du recht, auf einer Art Objektivität, die es nicht gibt. Journalisten sind Menschen. Menschen haben Meinungen. Menschen haben Antipathien. Menschen haben auch mal schlecht gefrühstückt oder sind bekifft. Es gibt keine «objektiven» Menschen, deshalb gibt es auch keinen «objektiven» Journalismus. Die einen geben das zu, die anderen nicht, ich kann hier nur für mich sprechen: Es ging mir immer um ein Näher-«dran»-Sein und darum, für das Erlebte eine aufregende, neue Sprache zu finden. Die journalistische Darstellung tatsächlicher Ereignisse begriff ich dabei bloss als Material und reicherte sie mit literarischen Techniken wie dem dialogischen Erzählen, Szenekonstruktionen, freien Gedankenassoziationen, aber auch ganz offen mit dem phantastischen Realismus an. Damals wurden die starren Grenzen zwischen Journalismus und Literatur, zwischen Schreiben und Leben selbst, fliessend. Bald begannen sich auch die etablierten Mainstreamblätter mit dieser Schule zu schmücken, «Tempo»-Autoren wurden überall verpflichtet und sie sollten das Profil der alten Publikationen auffrischen. Der subjektive Journalismus bekam so zusätzlichen Auftrieb.
Gehen wir dem ein wenig auf den Grund. Welchen Gewinn bietet die radikale Subjektivität dem geneigten Leser?
Irgendjemand hat mal gesagt, New Journalism sei ein anderes Wort für «Entheuchelung». Das fand ich gut. Das Ich-Erleben in subjektiven Texten dient als eine Art Filter der Weltwahrnehmung, in meinen Reportagen wurde es meistens als erkennbar stilisierter und heroisierter Rollenwechsel inszeniert, der den neutralen Beobachtungsposten des klassischen Informationsjournalismus irgendwann im Laufe des Textes aufgibt. Um zum Beispiel die Schrecken der Isolationshaft zu recherchieren, liess ich mich für eine Woche im Redaktionskeller einschliessen und verordnete mir ein striktes Kontaktverbot. Ich schrieb ein detailliertes Protokoll dieser Keller-Woche, das sich recht bald in ein totales Selbstporträt verwandelte und mit den RAF-Häftlingen in Stammheim – dem eigentlichen Thema – nichts mehr zu tun hatte. Aber eben: mit meinen Gefühlen in der Isolation.
Das klingt nun fast schmerzhaft, stammt daher der Begriff «Borderline-Journalismus»?
Der stammt vom stellvertretenden «Welt am Sonntag»-Chefredaktor und Kollegen Ulf Poschardt. Der Begriff wurde dann benutzt, um auf meine inszenierten Hollywood-Interviews zu verweisen und die «Tempo»-Schule zu diskreditieren. Was dabei vergessen wurde: die Idee der «Tempo»-Schule steht hinter meinen Reportagen, mit meinen Interviews hatte sie aber nie etwas zu tun.
Da muss ich nun die schmerzhafte Frage stellen: wie viel Schriftsteller darf, soll oder muss in einem guten Reporter stecken? Und umgekehrt?
Tom Wolfe hat mal freimütig zugegeben: um zu verhindern, dass sich seine Leser langweilten, sei ihm jedes Mittel recht. Wolfe, der sich seit Jahrzehnten als Dandy im cremefarbenen Anzug mit perfekt sitzender Krawatte inszeniert, gilt als ein Wegbereiter des «New Journalism» und ist heute einer der angesehensten US-Autoren.
Nun bist du ausgewichen. Ich frage also nochmal anders: Wo muss der Journalist dem Schriftsteller in sich Einhalt gebieten – und umgekehrt?
Wenn Texte abkippen in einen rein für den einzelnen Autor wichtigen Inhalt und bloss noch als Rechtfertigung für Egozentrik, Selbsterfahrung und persönlichen Lustgewinn funktionieren. Das wirkt auf mich heute nicht mehr frisch. Für mich geht es in Sachen Journalismus weiterhin darum, in einer verlogenen, korrupten und intriganten Welt nicht ständig so zu tun, als käme der Reporter von einem anderen Stern. Was immer sie in den orthodoxen Journalistenschulen sagen, was die Objektivisten predigen: es ist immer verdächtig. Sie sagen: «Halt› dich raus!» «Du sollst lediglich ein kabelloses Mikrophon sein, so ´ne Art Medium.» Dass Journalismus ein wildes Geschäft ist, schmutzig sowieso, natürlich auch korrupt, darüber darf nicht gesprochen werden. Und genau das muss heute geschehen.
Nun schreibst du aber auch für Zeitschriften, die sich weder wild noch besonders schmutzig geben, sondern sich gern das Image des «Saubermanns» angedeihen lassen. Wie passt das zu deinem Anspruch?
Wie bereits gesagt, als «Weltwoche»-Autor unterwerfe ich mich, so gut es geht, den Regeln des Journalismus. Das klappt auch ganz gut. Man muss sich eben manchmal entscheiden: Schon 1994 wurde mir vom «Tagi-Magi» der Job als Bundeshaus-Kolumnist angeboten. Dahinter steckte womöglich die nette Hunter-S.-Thompson-Idee: «Tom Kummer soll mal die Szene aufmischen.» Du weisst schon: der Autor wird zum Ereignis. Ich habe mich damals für Kalifornien und etwas mehr Ruhe, gegen die Institutionalisierung meiner Schreibe entschieden, das bereue ich nicht.
Wo sind denn heute deiner Meinung nach noch die Oasen des Meinungs- und Tendenzjournalismus?
Nehmen wir mal die «Weltwoche»: Da kommen die verschiedensten Positionen zu Wort, viele Wirklichkeiten werden präsentiert, von links bis rechts, und immer wieder wird mal ein multipler Spagat gewagt. Wir leben ja weiterhin in verwirrenden Zeiten, die grosse Blockbildung ist vorbei, in der besonderen Mischung liegt dann die Genialität des Zeitungsmachens. Das ist ein Weg zur Wahrheit. So war es schon bei «Tempo»: Da gab es Grossartiges neben sagenhaft Dämlichem. Zum Beispiel ein Test, welcher deutsche Bürgermeister auf Grundlage eines KZ-Grundrisses ein Lager für Aids-Kranke in seiner Stadt bauen würde, neben einer Top-Ten-Liste der «Sexidole 1986», in der Libyens Staatschef Gadhafi auftauchte, betitelt mit «Heiss wie Wüstensand». Als das Heft am Kiosk erschien, wurde in Berlin im Auftrag Libyens die Disko La Belle in die Luft gesprengt.
Du selbst hast eben Schriftsteller Tom Wolfe ins Gespräch gebracht. Wieso hast du eigentlich so lange für «deinen» Journalismus gekämpft und nicht – wie beispielsweise deine «Tempo»-Kollegen Maxim Biller, Marc Fischer und Christian Kracht – auch auf die Schriftstellerei umgesattelt?
Das ist ein Missverständnis. Ich habe nie einen Kampf gekämpft. Ich habe mich bloss eine Weile gegen die Heuchler im Betrieb gewehrt. Das war alles. Ich schreibe heute aber mehr als jemals zuvor: Notizen, Beobachtungen, Tagebuch. Ist das Schriftstellerei? Ich weiss es nicht. Aber der Roman, der kommt noch. Gute Literatur braucht Zeit.