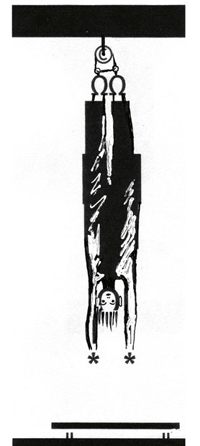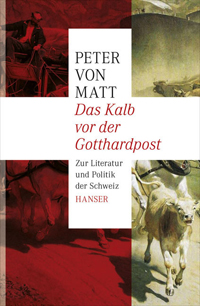Der Dichter und das Klischee
Warum der Kanon auch nur eine Sammlung von Stereotypen ist. Eine Provokation.
Paul Heyse (1830–1914) ist heute kaum mehr als ein Strassenname in Berlin und München. Zu seiner Zeit jedoch war er einer der berühmtesten Schriftsteller. 1910 erhielt er als zweiter Deutscher (nach Theodor Mommsen) den Literaturnobelpreis. Kaiser Wilhelm II. wollte ihn per Dekret fest im Schulkanon verankern. Theodor Fontane war überzeugt, dass man eines Tages eine ganze Epoche nach ihm benennen würde – so wie man heute noch von der «Goethe-Zeit» spricht. Doch daraus wurde nichts und es steht zu bezweifeln, ob heute überhaupt noch jemand den Namen Heyse kennen würde, hätte man nicht zu Lebzeiten die beiden Strassen nach ihm benannt. Heyse starb 1914 – wenige Monate vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Schon kurz nach dem Krieg war er so gut wie vergessen. Kaum eine Literaturgeschichte erwähnte ihn noch. Auch heute sucht man ihn darin vergebens.
«Wie kommt das?», fragt man sich. «Wie kann so etwas geschehen? Ein so berühmter Schriftsteller, ‹Goethes Statthalter auf Erden›» – (wie ihn die Zeitgenossen nannten) – «geht ‹klanglos zum Orkus hinab›?»
Begibt man sich auf die Spurensuche und durchforscht die Literaturgeschichte, gelangt man zu einem interessanten Befund. Zu seinen Lebzeiten porträtierten fast alle Literaturhistoriker Paul Heyse. Die meisten widmeten ihm sogar mehrere Seiten (inklusive Porträt und Autograph). Doch das, was man liest, ist fast überall das Gleiche. Es ist, als seien lauter kleine «Karl-Theodor zu Guttenbergs» am Werk gewesen. Einer scheint vom anderen abgeschrieben zu haben. Um es zu kaschieren, haben sie nur hier und da die Reihenfolge ein wenig verändert. Die Beschreibungen Heyses und seines Werks setzen sich allerdings aus einem festen Repertoire an nahezu «wörtlich» wiederkehrenden Urteilen zusammen: Heyse sei einer der «fruchtbarsten Schriftsteller», aber seinen Figuren fehle es an «Leben», sein Stil sei «formgewandt», aber «künstlich», «kühl» und «glatt», «aristokratisch», «erotisch» und «antireligiös». Er habe eine «novellistische Begabung», aber keinen Sinn für «Dramatik». Alles in allem zehn Schlagworte, auf die sich das Urteil Heyses in den Literaturgeschichten reduzieren lässt. Das Interessante ist, dass dieses Mosaikbild Heyses von Anfang an da war, das heisst ab der ersten Literaturgeschichte, die ihn erwähnt. Aber nicht nur das: es bleibt auch bis zu seinem Verschwinden gleich. Obwohl Heyse so unglaublich «fruchtbar» in seiner Produktion war und fast jedes Jahr mehrere Werke veröffentlichte, ändert sich an der Darstellung seiner Person und seines Werks über die Jahre nichts. Das ist erstaunlich, denn immerhin handelt es sich hier um einen Zeitraum von annähernd einem halben Jahrhundert. Von aussen betrachtet, scheint Heyse in seiner Entwicklung stehengeblieben zu sein. Die neuen Werktitel werden in den kurzen Abhandlungen zwar immer wieder ergänzt, aber sie dienen letztlich nur als weitere Beispiele ohnehin etablierter Schlagworte. Statt mit echten literarhistorischen Urteilen hat man es bereits zu seinen Lebzeiten mit Stereotypen zu tun.
Heyse ist kein Einzelfall. Betrachtet man die Darstellung anderer Schriftsteller, so stösst man auch dort in der Regel auf Klischees. Selbst die Grossen bleiben davon nicht verschont. Man betrachte nur einmal Goethe und die rückwärtsgewandte Auslegung des Weimarer Dichterfürsten als klassischen Nationalautor. Ganze Epochen werden auf bis heute gängige Topoi verkürzt: die Romantik etwa als «Gegenbewegung» zur Aufklärung und so weiter. All das wird über viele Jahre von Literaturgeschichte zu Literaturgeschichte nahezu unverändert kolportiert.
Natürlich ist das nicht verwunderlich. Bedenkt man, was ein Literaturhistoriker alles gelesen haben müsste, um eine fundierte Literaturgeschichte von den Anfängen bis in die Gegenwart zu schreiben, könnte er erst im Alter Methusalems mit seiner Abfassung beginnen.
Sich selbst zitieren und bestätigen
Doch woher nimmt der Literaturhistoriker eigentlich die Klischees, wenn sie – wie bei Heyse – von Anfang an zu finden waren? Sie scheinen ja keine Erfindung der Literaturgeschichte zu sein. Die Frage ist nicht leicht zu beantworten. Im Falle Heyses haben wir allerdings Glück. Einiges lässt sich gut nachvollziehen: eine der ersten Literaturgeschichten, die Heyse darstellte, war die des Vormärz-Publizisten Robert Prutz. Bevor er Ende der 1850er Jahre «Die deutsche Literatur der Gegenwart» veröffentlichte, betätigte er sich in erster Linie als Literaturkritiker in der damals hochrenommierten und von ihm herausgegebenen Zeitschrift «Deutsches Museum». In dieser Zeitschrift verfolgte Prutz die Karriere Heyses von Anfang an – nicht unbedingt wohlwollend. Er kannte den jungen Mann noch aus Berlin, wo Prutz im gleichen Haus mit Heyses Mentor Emanuel Geibel wohnte. In seinen Kritiken prägt Prutz viele der Klischees vor, die Heyses Bild auf Jahrzehnte bestimmten. Womöglich hat er dabei einiges von anderen Rezensenten übernommen. Das lässt sich nicht nachweisen. Sich selbst aber zitierte und kopierte er immer wieder und bestätigte damit ein einmal von ihm gefälltes Urteil. Es verwundert daher auch nicht, dass er für das Heyse-Porträt seiner Literaturgeschichte die zuvor verfassten Artikel zusammenfügte. Hier und da ergänzte er einige Übergänge und Werktitel. Im Grossen und Ganzen beliess er alles.
Der Einfluss der Prutz’schen Literaturgeschichte vor allem auf andere Literaturhistoriker ist immens. Und so erstaunt es wenig, wenn sich Passagen seiner Literaturgeschichte fast wörtlich in anderen wiederfinden – beispielsweise in der von Adolf Bartels, einem der bedeutendsten Vertreter der sogenannten «Heimatkunstbewegung». Man muss Bartels zugutehalten, dass er Prutz zumindest in seinem Vorwort als Bezugsquelle erwähnt. Andere übernehmen da schon viel ungenierter. Und so tradiert sich ein einmal entworfenes Bild über Jahre hinweg.
So Literaturgeschichte wie Kanon
Doch warum wird ein Dichter wie Heyse überhaupt in eine Literaturgeschichte aufgenommen und wie kommt es, dass er eines Tages sang- und klanglos wieder verschwindet? Die Klischees, die über ihn vorherrschen, sind ja nicht gerade rühmenswert. Die Erklärung ist einfach: jede Literaturgeschichte ist letztlich nichts anderes als ein Kanon. Das bedeutet, dass sie nicht nur eine Auswahl an Autoren und Texten verbindlich festzuschreiben versucht, sondern auch, dass sich dahinter eine kulturelle Gemeinschaft verbirgt, die sich selbst in dieser Auswahl repräsentiert sieht. Mit anderen Worten: eine Literaturgeschichte präsentiert nicht nur einen kommentierten Katalog literarischer Werke, sondern gleichzeitig auch den Wertekanon dieser Gemeinschaft. Historisch bedingt ist dies in den deutschen Literaturgeschichten des 19. Jahrhunderts bis Mitte des 20. der Wertekanon des Bürgertums. Die sich im 19. Jahrhundert etablierende Gesellschaftsschicht sah in der Literaturgeschichte nämlich das vorgeprägt, worauf sie in der politischen Geschichte so lange vergeblich gehofft hatte; entsprechend nutzte sie die Literaturgeschichte, um ihre eigenen Werte auszudifferenzieren.
So versteht sich von selbst, dass sich vornehmlich diejenigen Autoren dauerhaft im Kanon etablierten, über die seitens der Literaturgeschichte (Vor-)Urteile gefällt wurden, die mit den national bürgerlichen Werten vereinbar waren. Bei Heyse war das nicht der Fall. Im Gegenteil: die Klischees, aus denen sich sein Porträt zusammensetzt, zeichnen eher einen Gegenentwurf. Betrachtet man sie genauer, so gleichen sie den Vorurteilen, die man gegenüber der Aristokratie hegte: moralische Verderbtheit, Oberflächlichkeit, Schönrednerei und so weiter. Von ihnen wollte man sich bewusst abgrenzen. Von Anfang an wurde Heyse deshalb negativ kanonisiert. Dass er überhaupt in die Literaturgeschichte aufgenommen wurde, liegt zum einen daran, dass man durch ihn die eigentlich repräsentative Auswahl schärfer konturieren konnte. Zum anderen muss man annehmen, dass die Literarhistoriker zu Heyses Lebzeiten einfach nicht um ihn herumkamen. Er war zu gut etabliert. Viele seiner Werke, insbesondere seine Novellen, entsprachen genau dem Zeitgeschmack – wie allein die hohen Auflagenzahlen zeigen. Mit gerade einmal zweiundzwanzig Jahren und nicht einmal einer Handvoll Veröffentlichungen wurde er an den Hof Maximilians II. nach München berufen. Ausserdem war Heyse ein ausgezeichneter Netzwerker: viele Dichter (unter ihnen auch Fontane) suchten seine Nähe. Sie wussten, dass ein Wort Heyses an der richtigen Stelle oft genügte, um ihre Publikationen unterzubringen und vor allem um Autoren populär zu machen. So war Heyse seinerzeit beispielsweise wesentlich dafür verantwortlich, dass Dostojewski in Deutschland berühmt wurde. Die Literaturgeschichten mussten ihn aufnehmen. Er war im Literaturbetrieb seiner Zeit ein VIP.
Das erklärt aber auch, warum er so kurz nach seinem Tod wieder verschwand. Im literarischen Alltag war er einfach nicht mehr präsent und seine Werke waren zu wenig repräsentativ für Werte, die man in den Literaturgeschichten vertreten sehen wollte. Zudem hatten sich diese Werte nach dem Ersten Weltkrieg und der demokratischen Umgestaltung der Gesellschaft auch bedeutend geändert.
Strassenschilder im literarischen GPS
Paul Heyse ist natürlich nur ein Beispiel. Doch wie ihm erging es vielen Autoren: Otto Ludwig, Victor von Scheffel, Ludwig Spielhagen… Sie alle waren zu ihrer Zeit äusserst erfolgreich, wurden aber von der Nachwelt vergessen, weil ihre Werke (bzw. das Urteil darüber) nicht kompatibel waren mit dem Selbstbild der Trägerschicht. Erst wenn Urteil/Klischee und Wertekanon übereinstimmen, kann sich ein Autor fest im Kanon etablieren – und als Goethehain (Gräfenhainichen), Schillersteig (Katzhütte) oder Günter-Grass-Weg (Herbrechtingen) ebenso massen- wie dauerhaft auf den Schirmen des literarhistorischen GPS aufblinken. Wenn das allerdings einmal geschafft ist, dann hält ein solcher Name sich länger als das durchschnittliche Strassenschild, denn natürlich werden in diesem Fall – anders als bei der Negativkanonisierung – die Klischees immer wieder aktualisiert und dem jeweiligen Wertekanon angepasst.
Und wie ist es heute? Kann es Phänomene wie Heyse auch heute geben? Oder verhindert die digitale Omnipräsenz selbst literarischer Eintagsfliegen jede Form kollektiver Demenz? Man werfe einen Blick auf die Liste der Literaturnobelpreisträger der letzten fünfzig Jahre. Wie viele Namen sind uns heute noch bekannt, wie viele werden heute noch gelesen, wie viele kennt man nur mehr als Klischee? Es hat sich kaum etwas geändert in den letzten hundert Jahren. Das Einzige, was sich geändert hat, ist die Trägerschicht, die definiert, was erinnert oder vergessen wird. Die Gesellschaft hat sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts pluralisiert, sie ist vielschichtiger geworden. Es ist nicht mehr vor allem eine Gruppe, die den Kanon postuliert. Inzwischen hat jede Gruppe und jede Gemeinschaft ihren eigenen Kanon. Über ihn bestimmen sie ihre Werte, über ihn grenzen sie sich von anderen ab. Aber genauso wie es früher das Bürgertum tat, unterziehen sie Autor und Werk (wenn überhaupt) nur einer einseitigen, verkürzenden Lektüre. Auch hier dominieren Klischees und Vorurteile: man denke nur an diese ganzen sich selbst bestätigenden Erwartungshaltungen der Kritik à la: «Schriftstellerin X oder Schriftsteller Y schreibt wie ein neuer Walser.»
Und zu guter Letzt: Hand aufs Herz – wer hat nicht schon selbst ein Buch empfohlen oder verrissen, das er gar nicht gelesen hat, sondern nur die Vorurteile von anderen übernahm? Sei es von Bekannten oder aus der Literaturpresse. Wobei freilich eines zu hoffen bleibt: dass wenigstens Letztere es auch gelesen haben mögen.
Christoph Grube
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Neuere Deutsche und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Technischen Universität Chemnitz. Er promovierte zum Thema «Mechanismen literarischer Kanonisierungsprozesse».