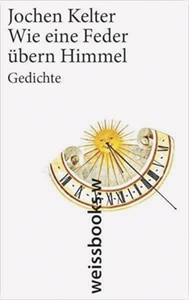«Der Himmel ist nicht immer blau»
Wo Leo Tuor wohnt, dahin fährt kein Postauto. Der Schriftsteller und studierte Philosoph arbeitet als Hirte, er verbringt die Sommer mit seiner Familie auf einer Alp. Am Stubentisch streifen wir durch die Berge, aber vor allem durch seine zweite Heimat, die Weltliteratur.

Herr Tuor, Sie haben mich vor etwa einer Stunde am Bahnhof Sumvitg Cumpadials mit dem Auto abgeholt, von wo aus wir ein steiles Seitental hinaufgekurvt sind – bis zum Dorf Val. Hier, weit oben im Val Sumvitg, unterhalb der Greina, leben Sie zurückgezogen als Schriftsteller. Was bedeuten Ihnen die Berge?
Dasselbe wie die Sprache. Ich bin hier oben aufgewachsen. Im Flachland fühle ich mich ausgeliefert. Berge schützen mich. Natürlich, sie können auch einengen. Doch haben sie den Vorteil, dass man ihrer Enge entfliehen kann. Auf die Berge kann man hinaufsteigen und von oben hinabblicken.
Sie waren selbst 14 Sommer lang der Hirt auf der Greina, bevor Sie Ihren Erstling «Giacumbert Nau» geschrieben haben, den poetischen Hirtenroman ohne Idylle, «Onna Maria Tumera» ist eine Familiengeschichte aus Ihrer Heimat, für «Settembrini» haben Sie das Jagdpatent gemacht: Ist Ihnen die eigene Erfahrung in Ihren Geschichten wesentlich?
Für mein Schreiben ist das sehr wichtig. Ich muss mir den Stoff einverleibt haben. Es gibt Autoren, die ohne das auskommen, Karl May und andere. Aber ich will selbst erlebt haben, worüber ich schreibe, nur so komme ich in die Tiefe und kann dem Leser, wenn er denn will, eine vertikale Lektüre bieten, nicht nur eine horizontale. Ein Buch, das zu einem geistigen Gebrauchsgegenstand werden kann, den man immer wieder zur Hand nimmt. Ich beschäftige mich sehr lange mit meinen Texten, und lange bevor ich eigentlich zu schreiben beginne. Man kann sagen, dass sie im Grunde oft gar nicht am Schreibtisch entstanden sind.
Die Berge als Inspiration und Ort des Schreibens. Dabei musste die Bergwelt in der Literatur für vieles herhalten. Sie wird verkitscht, ideologisiert und idealisiert. Die Berge als grosser Freiraum. Wie ist es nun, wenn man wirklich dort lebt, im grossen Freiraum Greina?
Ganz einfach: man arbeitet da oben. Der Mensch braucht eine Tätigkeit. Man hütet Schafe, jagt oder strahlt. Was tut der Tourist? Er ist begeistert, fotografiert vielleicht, macht aber in den Augen der Bergler nichts Sinnvolles. Der Tourist verlangt vom Einheimischen, dass er ebenfalls begeistert sei. Idealisiert haben nicht wir die Berge. Das waren die klassischen Dichter, wie Dante, Petrarca, Tasso oder Haller, weil sie die Literatur der Antike kannten und auf die Berge bezogen nachgeahmt haben. Für den Bündner Jäger ist die Gegend alltäglich. Der Himmel ist nicht immer blau.
Gibt es für Sie einen Unterschied zwischen Literatur über die Berge und Literatur aus den Bergen?
Letztere hat vielleicht mehr Seele. Wenn ich etwas nicht nur recherchiert oder besucht habe, sondern es erlebe, dann kommt der Text aus mir selbst heraus. Bei «Settembrini» ging es mir unter anderem darum, diese alte Bündner Jagd zu beschreiben – und was in den Köpfen dieser Menschen vor sich geht. Diese Welt kann nur kennenlernen, wer das Jagdpatent macht. Mit dem Buch geht das nun auch ohne. Ich hoffe, damit ein paar Tieren das Leben gerettet zu haben. (lacht)
Weil die Leser nicht mehr selbst Jäger werden müssen…
…und weil sie dann nicht mehr «Mörder» rufen müssen, wenn sie mich mit einem geschossenen Tier auf dem Buckel antreffen. Wer in der Gegend um die Terri-Hütte jagt, ist oft mit Touristen konfrontiert. Aber, bitte schön, am Vorabend sassen die gleichen Leute bequem in der Hütte und haben Fleisch gegessen, das mit dem Helikopter für sie hinaufgeflogen wurde, das mit riesigem Aufwand von irgendwoher auf ihren SAC-Tisch kam. Wenn die dann einem Jäger begegnen, der eine Woche umhergestreift ist und mit einer Gemse für sich und seine Familie absteigt, merken sie vielleicht wieder, in welchem Lebensraum sie sich gerade bewegen, dass auf der Greina das Fleisch nicht aus der Kühltruhe kommt. Aber es stimmt schon, nur noch die wenigsten betreiben die alte Jagd. Das Töten ist heute ein Sport geworden. Und die Jäger in «Settembrini» sind ideale Jäger, nicht so, wie sie sind, sondern so, wie ich sie gerne hätte.
Also doch Imagination.
Literatur beschreibt nicht den Status quo. Sie sollte kritisch sein, von mir aus gesehen, Fenster öffnen und Welten, den Leser zum Denken bringen. Ein Buch über die Jagd zu schreiben ist sehr schwierig. Man kennt ja diese Stammtischgeschichten: Der Jäger ist immer der Held. Er erzählt von sich und für sich, ob ihm andere zuhören oder nicht. Wie früher, wenn sie aufs Militär kamen. Das wollte ich nicht. Ich will keine Heimatromane schreiben. Es war in den Ferien in Israel, als ich nachts am Meer stand und sich im Wasser das Firmament spiegelte. Da wurde mir klar, dass ich die Jagd mit den Sternen verbinden musste, mit den alten Mythologien. Auch von der Sprache her interessierte mich, ob man den Homer ins Romanische übertragen kann. Meine Jäger sind literarische Kunstfiguren, doch als das Buch in der deutschen Übersetzung erschien, zeigte sich, dass diese Jäger mit dem humanistischen Bildungshintergrund tatsächlich existieren. Ich erhielt überraschende Feedbacks.
Welcher Art?
Es gibt ihn, den intellektuellen Jäger, wie es den intellektuellen Krieger gibt. Kürzlich las ich in einem Buch über Horaz die Geschichte eines englischen Majors, der in Griechenland 1944 einen deutschen General gefangengenommen hatte. Als die Sonne aufging, sah General Kreipe den Schnee auf dem Berg Ida leuchten und begann, eine Horaz-Ode zu zitieren, worauf der Engländer seine Zeile zu Ende sprach. Damit fanden sich die Todfeinde im Humanismus vereint. Ähnlich erging es mir mit diesen weit entfernten Jägern, die mir nach ihrer Lektüre schrieben. Aber das ist nur die eine Seite. In meinen Büchern möchte ich für den Mann des Volkes schreiben wie auch für den Intellektuellen. Im Hirten «Giacumbert Nau» haben sich beide wiedergefunden. Es gibt junge Jäger, die mir sagten, sie hätten seit der Sek kein Buch mehr in die Finger genommen, aber den «Settembrini» haben sie von vorn bis hinten gelesen, inklusive der Homer-Passagen.
Die Weltliteratur scheint Ihnen neben den Bergen eine zweite Heimat zu sein. Sie sagten einmal über sich, Sie seien eher der Leser als der Schreiber.
Ich finde Lesen viel spannender als Schreiben. Schreiben ist eine extrem mühsame Sache. Wieso so viele Leute schreiben, ist mir ein Rätsel. Vielleicht müssen sie ein Buch gemacht haben für die Unsterblichkeit. Irgendwas hat es. Es gibt schon auch Schriftsteller, die begnadet sind, denen es leicht fällt, die viel schreiben und das sehr gut. Ich bin nicht so einer.
Aber dennoch gibt es den Drang zum Erzählen. Gerade bei Menschen, die Abgeschiedenheit suchen, die das Zurückgezogene doch so sehr lieben. Jäger etwa sind endlose Erzähler.
Das ist Kultur. Das hat etwas Archaisches. Ums Feuer sitzen und erzählen. Auch bei Homer war ursprünglich alles mündlich. Kein Jäger schreibt. Das will er nicht, das kann er nicht. Aber alle können erzählen. Ich meine damit nicht das, was sich unter den Trophäen abspielt, sondern wenn sie in den Hütten unter sich sind. Wenn Hirten und Jäger eine hermetische Gemeinschaft bilden. Hier kommen die Geschichten von früheren Jägern hoch, von Originalen, die einige noch kannten. Sehr humorvoll, sehr komisch. Dort taucht auch die Geisterwelt auf. Mich hat daran natürlich auch die Sprache fasziniert, die Melodik dieser Berichte.
Ist dieses Erzählen auch Selbstvergewisserung im Dilemma von Jagen und Töten? Die Jäger in «Settembrini» sprechen immer wieder von ihren persönlichen Moralvorstellungen, ohne die sie offenbar nicht auskommen. Ist «Settembrini» auch so etwas wie ein Versuch über eine Moral für die Jagd?
Das war wahrscheinlich ein Hauptgrund, dieses Buch zu schreiben: das Problem des Tötens. Ich habe viele gefragt: macht dir das nichts? Alle verneinten. Aber ich glaube es ihnen nicht. Als Hirt musste ich oft töten, verletzte Tiere mit einem Stein oder einem Pickel, was grad da war. Ihr Leiden hätte viel zu lange gedauert, bis der Bauer aus dem Tal hochgestiegen wäre, womöglich noch ohne Pistole. Mir hat das sehr wehgetan. Auch das Töten von Wild ist schwierig für mich. Weil man das Tier sehr lange beobachtet. Mit der heutigen Technik zoomt man eine Gemse bis auf zwei Meter heran. Man erkennt, ob man dieses Tier schiessen darf, und entscheidet, ob man abdrückt – oder eben nicht. Das muss jeder mit sich ausmachen.
Aber ein Jäger, der nicht schiesst, wird ausgelacht.
Je mehr einer erlegt, desto höher sein Ansehen. Das versuche ich zu demontieren, bin mir aber nicht sicher, ob das gelungen ist. Das Töten in einer Gesellschaft, die das eigentlich nicht muss, hat viel mit Macht, Gewalt, Vergewaltigung zu tun. Reif ist ein Mann, ein Jäger erst, wenn er auf das Töten verzichten kann. Aber nur sofern man Jagd als Sport betrachtet. Wenn man für das eigene Überleben jagt, ist es wieder ganz etwas anderes. Aber Fleisch essen geht sowieso nur, wenn man verdrängt.
Wahrscheinlich. Auch wer ein Buch über die Jagd schreibt, begibt sich auf umstrittenes Terrain. Es gibt wenige Werke, die es wagen, diesem Thema beizukommen. Welches waren Ihre literarischen Referenzpunkte?
Natürlich war «Moby Dick» ein Vorbild. Ein gewaltiges, ein geniales Werk mit seinen Bezügen zur Bibel und der Literatur. Auch weil Melville selbst auf diesen Walfängern angepackt hat, das merkt man, dass er diese Welt auf der Haut gespürt hat, die Lebensgefahr. Hemingways «Der alte Mann und das Meer» war ebenfalls wichtig, obwohl ich meine Probleme mit ihm habe, aber er ist ein Autor, der authentisch wirkt, weil er Reporter war, weil er das alles auch erlebt hat. In der Schweiz gibt es «Die graue March» von Meinrad Inglin. Und in der Philosophie ist es Ortega mit seinen «Meditationen über die Jagd», von denen ich gerne hätte, dass sie jeder Jäger gelesen hat. Und auch jeder Nichtjäger.
«Settembrini» wirkt gewichtig und ambitioniert. Der Nachfolger «Cavrein», in dem es wieder um die Jagd geht, leicht und humorvoll. Ist «Cavrein» eine nachträgliche Relativierung?
Nicht bewusst. Ich habe es als Tagebuch, also sehr schnell geschrieben und erst gar nicht an ein Buch gedacht. Es geht um die sehr spezielle Steinbockjagd, diese zweieinhalb Wochen im Herbst. Jeden Abend habe ich mir Erlebnisse aufgeschrieben, hinzugedichtet und die Texte erst hinterher literarisch bearbeitet. Das Buch kam dann – für mich untypisch – sehr schnell. Und leicht. Eine Sonate, keine Sinfonie. Im Romanischen fand sie aber kaum Anklang: Aha, schon wieder Jagd. Es gibt eine Buchvernissage, dann ist der Saal voll, aber danach hört man nichts mehr. Erst mit der deutschen Übersetzung hat sich gezeigt, dass «Cavrein» ein Echo hat.
Wie sehen Sie also die Zukunft der rätoromanischen Sprache?
Sie ist bedroht. Durch das Deutsche, das Englische, den Einfluss der medialen Welt. Aber solange wir romanisch reden, eine Literatur und vor allem Kinder haben, die wir überzeugen können, diese Sprache zu sprechen, wird sie überleben. Doch ewig wird das nicht dauern. Selbst Lateinisch ist untergegangen und Englisch wird auch mal verschwinden. Ich finde es nicht tragisch, wenn Sprachen untergehen. Sie sind immer gekommen und gegangen.
Ihre Literatur ist also kein Versuch, eine bedrohte Sprache zu bewahren, Kulturen zu beschreiben, bevor sie verschwunden sind?
Es ist schon so, dass es den originalen Jäger kaum noch gibt. An seine Stelle ist der Sportjäger getreten mit seinem Kult, den es hier oben nie gegeben hat. Dieses Halali ist erst in den letzten dreissig Jahren aus Österreich und Süddeutschland importiert worden. Auch sind es kaum noch Einheimische, die als Hirten gehen. Das Alpleben rechnet sich nur noch für Auswärtige. Da geht eine alte Kultur kaputt. Aber in jedem Tal gibt es noch einen, der jeden Felsecken kennt und alles weiss. Nur reden die nicht mit jedem. Man muss sich ihnen vorsichtig nähern, bevor sie einem erzählen. Das Original und die Originale werden nie ganz verschwinden. Die lassen sich nicht ausmerzen. Sogar Latein ist nicht tot, solange es noch Menschen gibt, die den Ovid lesen.