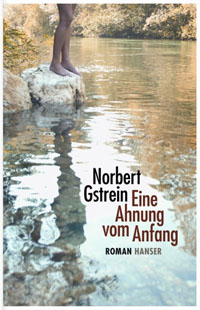Sich Kafka nähern
Der Biograph überblendet Geschichte und Geschichten sowie eine Vielzahl weiterer Diskurse, um vergangene Zeiten erlebbar zu machen. Aber: wie genau macht er das eigentlich? Begegnung mit einem Kafka-Biographen.

Herr Stach, Sie haben sich achtzehn Jahre der Lebensgeschichte Kafkas verschrieben, kennen wie kein zweiter die Fakten und Fiktionen rund um Kafka, die Geschichte Kafkas, auch die Geschichte seiner Rezeption. Welches landläufige Kafka-«Faktum» würden Sie am liebsten per Dekret aus der Welt schaffen?
Vor allem die Ansicht, dass Kafka vom Ersten Weltkrieg nicht berührt wurde – nur, weil er kein Soldat war. Ich bin viel an Gymnasien unterwegs, da hört man das oft. Dabei war der Erste Weltkrieg Kafkas Lebenskatastrophe. Er hatte kurz vor Ausbruch beschlossen, vom Schreiben zu leben, hatte dafür gespart, und Robert Musil wollte ihm in Berlin eine Stelle organisieren. Bei Kriegsausbruch wurde dieser Plan jedoch hinfällig, denn nach einer Kündigung seines Bürojobs wäre Kafka sofort eingezogen worden. Auch durfte er als Dienstpflichtiger nicht ins Ausland, selbst Telefonkontakte waren unmöglich. Kaum hatte er also beschlossen, Prag, Familie und Versicherung zu verlassen, machte der Krieg alles zunichte. Die Hälfte seiner Kollegen war im Krieg, Kafka musste für sie einspringen: das bedeutete zahllose Überstunden – in einer Zeit, in der er literarisch äusserst produktiv war. Ausserdem war sein Erspartes weg, weil er Kriegsanleihen kaufen musste. Schliesslich sah Kafka auch die psychisch und physisch verwundeten Kriegsheimkehrer, täglich strömten sie in sein Büro. Er wusste von den Elektroschocks, die zur Heilung von Traumatisierten verwendet wurden – und er dürfte sich im übrigen auch bei den Soldaten mit Tuberkulose angesteckt haben. Er wusste also weit mehr über die Kriegsfolgen als viele seiner Zeitgenossen. Hinzu kamen die schlechte Versorgung und die Kälte, unter der Kafka genauso litt wie seine Mitmenschen. Doch im Gegensatz zu seiner sonstigen Tendenz zum Klagen hat er sich über dieses allgemeine Leid niemals beklagt, und deshalb unterschätzen wir das. Ganz zu schweigen davon, dass die Briefzensur es ohnehin unmöglich machte, darüber zu schreiben.
Können Sie sich an Ihre erste Kafka-Lektüre erinnern?
In den 60ern hatte «Der Prozess» zwar riesige Auflagen, aber obligatorischer Schulstoff war der Roman noch nicht. Ich hatte Deutschlehrer, die in den 30ern ausgebildet worden waren, die wussten nichts über Kafka. Zum Glück haben mich Schüler aus anderen Klassen auf ihn aufmerksam gemacht. Was haben wir gelacht bei der Lektüre! Doch Kafka wurde erst zehn Jahre später mein wichtigster Autor, als ich seine Tagebücher und Briefe las. Ich wusste sofort: wer davon unberührt bleibt, ist illiterat.
Wie wichtig sind Kafkas autobiographische Texte fürs Verständnis seiner Prosa?
In seinen Briefen und Tagebüchern bereiten sich häufig Metaphern und Motive vor, die dann in seiner Prosa weiter ausgearbeitet werden. Wenn man versteht, wie er auf diese Metaphern kommt, versteht man besser, welche Rolle sie in seiner Prosa spielen. Bei keinem Autor kann man so gut wie bei Kafka beobachten, dass er immerzu aus ein und demselben Reservoir schöpft – einerlei, ob er einen Roman schreibt oder eine Postkarte an seine Schwester.
Welche Rolle spielt Max Brod für die aktuelle Kafka-Rezeption?
Glücklicherweise keine mehr. Heute erscheint es uns fast komisch, in welch präpotenter Weise Brod jahrzehntelang die Deutungshoheit über Kafka beanspruchte und dabei von dessen literarischer Modernität und Radikalität doch offensichtlich keine Vorstellung hatte. Das zeigte sich nicht zuletzt daran, dass er literarische Erben Kafkas wie etwa Beckett sofort als absurd oder nihilistisch abtat, während er Kafka selbst als positiven, lebenszugewandten Autor sehen wollte. Brod hatte viel Charme und Originalität als junger Mann, im Alter jedoch entwickelte er sich zu einer intellektuell windigen, unangenehm auftrumpfenden Figur, die man besser nicht beim Wort nimmt, schon gar nicht als Biograph.
Warum sind Biographien so beliebt beim Publikum?
Folgt man dem Leben einzelner, wird die Welt scheinbar übersichtlicher, und das ist ein dringlicher Wunsch, dem sich kaum mehr jemand entziehen kann. Und natürlich wird unser Voyeurismus befriedigt und unser Verlangen nach menschlicher Nähe. Es ist wie bei TV-Serien – man nimmt über lange Zeit am Leben anderer teil, so intensiv, dass diese Leute «Familienmitglieder» werden. Dieser Publikumserfolg macht es den Literaturwissenschaftern allerdings auch leicht, das Genre zu unterschätzen – durchaus berechtigt, was die Menge schlechter Biographien betrifft. In der Geschichtswissenschaft ist es anders, dort gilt die Biographie längst als wertvolles Erkenntnisinstrument. In Biographien über Wilhelm II. oder Ludendorff, um zwei besonders unangenehme Figuren zu nennen, erfährt man sehr viel über die Strukturen und Mentalitäten der damaligen Zeit. Das kann eine gute Biographie jedoch auf allen Feldern leisten, finde ich.
Warum sieht man das in der Literaturwissenschaft anders?
Weil man bedeutende Schriftsteller als singuläre Gestalten sieht, die sich nur über individuelle Schöpfungen definieren. Man könne, so der grosse Irrtum, aus ihrem Leben einiges über das Werk lernen, aber nicht über «die Literatur an sich». Solche Vorbehalte bekomme ich auch noch heute oft zu hören. Im angelsächsischen Raum war man schon in den 30er Jahren weiter, auch Virginia Woolf hat über die Biographie als Erkenntnisinstrument geschrieben. Bei uns begann man sich erst in den 70er, 80er Jahren darüber Gedanken zu machen. Als dann Rüdiger Safranski seine ersten Biographien veröffentlichte, war das Erstaunen gross – plötzlich merkten die Kritiker, dass man durchaus wissenschaftlich fundierte Biographien schreiben kann, die lesbar sind und Breitenwirkung haben. Was mich an diesem Genre vor allem fasziniert ist, dass der Biograph so viele Diskurse beherrschen muss: Sozial- und Literaturwissenschaft, Mentalitäts- und Politikgeschichte und viele andere mehr. Alle diese Erkenntnisformen müssen in einem Text zusammenfinden. Wenn es ein inhärent interdisziplinäres Forschungsunterfangen gibt, ist es das der Biographie. Ich hätte wirklich Lust, dazu einmal ein Symposion zu veranstalten – aber natürlich nicht an einer Universität, sondern dort, wo die Leser dann auch hinfinden.
Was ist der Unterschied zwischen fiktionalem biographischem Erzählen und dem Erzählen einer sich an realem Gegenstand orientierenden Biographie?
Wenn Sie eine Biographie schreiben, schwimmen Sie in einem gut gesicherten Pool. Es ist zumeist sehr, sehr viel Material, der Pool kann sehr gross sein, aber wenn es mit dem Schwimmen nicht klappt, können Sie stehen. Wenn Sie hingegen einen fiktionalen biographischen Roman schreiben, müssen Sie alles erfinden. Sie schwimmen auf hoher See, haben keine Gewissheiten. Der Romanautor kann daher viel grundsätzlicher scheitern als der Biograph. Schauen Sie sich die letzten Manuskriptseiten des «Schloss»-Romans an, dort können Sie beobachten, wie Kafka buchstäblich den Halt verliert, wie ihm alles entgleitet. Ich selbst könnte sehr wahrscheinlich keinen Roman schreiben, ich brauche die Sicherheit, auf dem richtigen Weg zu sein oder zu diesem Weg zumindest zurückfinden zu können – und die kann ich nur haben, wenn ich mich an die Fakten halte.
Würden Sie die Biographie eines noch lebenden Menschen schreiben?
Man sollte generell keine Biographien über Lebende schreiben (lacht). Das weiss man nicht erst seit Helmut Kohls Biographie und den juristischen Streitereien, die sie auslöste. Man hat zu wenig Distanz, muss zu viele Rücksichten nehmen und sogar mit Widerstand rechnen. Volker Hage vom «Spiegel» etwa war der erste, der eine Biographie über Marcel Reich-Ranicki schrieb. Er kannte Reich-Ranicki gut, und dennoch hat der ihm vieles verschwiegen, etwa den Umfang seiner Tätigkeit für den polnischen Geheimdienst. Ganz gleich, wie man diese Tätigkeit bewertet – für mich blieb der unangenehme Eindruck, dass hier der Biographierte seinen Biographen hat auflaufen lassen und dass er dessen Arbeit damit vorsätzlich entwertet hat. In solche Abhängigkeiten würde ich mich nicht begeben wollen.
Hatten Sie bei Ihrer Recherche Kontakt zu Kafka-Zeitzeugen?
Als ich anfing, lebten noch Nichten, die sich an «Onkel Franz» erinnerten. Aber sie wussten naturgemäss nicht viel, sie waren noch Kinder damals. Und ihre unscharfen Erinnerungen waren überschattet vom späteren, wahrhaft entsetzlichen Familienschicksal der Kafkas. Die Tochter von Ottla, Kafkas liebster Schwester, erzählte eindringlich, wie Ottla ins KZ transportiert wurde: wie kann ich über Kafka schreiben, ohne zu sagen, wie es seinen Angehörigen erging? Ich fügte also einen Epilog hinzu, in dem ich zumindest skizzierte, welche Gewalt über Kafkas familiäres und kulturelles Umfeld später hereinbrach. – Ein ganz anderer Fall war der Sohn von Felice Bauer, den ich zweimal in den USA besuchte. Es war haarsträubend, was ich da alles erfuhr, diese vielen Familienskandale, die man alle Kafka zu verschweigen versuchte. Etwa, wie Felice all ihr für die Hochzeit mit Kafka Erspartes für ihren Bruder ausgab. Der hatte seinen Chef bestohlen und musste nach Amerika fliehen. Felice finanzierte ihm alles – während Kafka sich fragte, warum Felice neben ihrem Hauptberuf noch Nebenjobs annehmen musste.
Sie wechseln in Ihrer Biographie zwischen grosser und kleiner Geschichte, zwischen dem Prager Fenstersturz und der Grösse von Kafkas Schulklasse. Wie viel Freiheit lässt der Rechercheur dabei dem Schriftsteller?
Um Kafka in seinen Entscheidungssituationen zu verstehen, muss man ausholen und Geschichten erzählen. Beispielsweise waren die Juden in Prag zu Kafkas Lebzeiten juristisch gleichberechtigt. Aber wie finde ich heraus, wie das tatsächlich war, im Alltag? Gewiss nicht aus der Tagespresse, denn die war zensiert. Das geht nur über einen Umweg, etwa über Kafkas Freund Hugo Bergmann, der Philosophie studierte und von einer akademischen Karriere träumte. Was geschah? Bergmann bekam trotz bester Empfehlungen von allen Unis nur Absagen, musste seinen Lebensunterhalt als Hilfskraft in einer Bibliothek verdienen. Ein Professor riet ihm sogar ausdrücklich, dass er es sich bei allem Talent mit einer katholischen Taufe einfacher machen würde. Das muss man wissen, um zu verstehen, warum Kafka Jura studierte – ein langweiliges Studium, das nichts mit seinen musischen Interessen zu tun hatte, aber eben eines, mit dem er auch als Jude zu einer angesehenen Stellung gelangen konnte.
Warum kommt eine Biographie nicht mit dem nüchternen Duktus anderer Sachbücher aus?
Solche nüchternen Biographien gibt es, aber sie haben grosse Schwierigkeiten, komplexe soziale Beziehungen anschaulich zu machen. Nehmen Sie als Beispiel Kafkas gescheiterte Verlobungen: natürlich könnte ich alle Faktoren auflisten, die auf ihn einwirkten – die einschlägigen Talmud-Stellen, die er im Tagebuch zitiert, die Angst des unverheirateten Schriftstellers, den sozialen Druck, die Fragen der Sexualität, der weibliche und männliche Sozialcharakter in jener Zeit, die Dominanz des Vaters. Eine solche Auflistung genügt mir aber nicht, denn es ist ja offenkundig, dass alle diese Faktoren sich auch gegenseitig beeinflussen. Darum muss ich das erzählen. Das heisst, ich drösle nicht diesen Knoten in einzelne Fäden auf, sondern zeige ihn in seiner sinnlichen Komplexität. Das Erzählen ist also nicht nur unterhaltsamer für die Leser, sondern auch eine Methode, um Komplexität zu vermitteln. Auch wenn viele schlechte Biographien genau das Gegenteil tun, also Geschichtchen erzählen, wo sie eigentlich erklären müssten.
Welche Bedeutung hat die Literaturwissenschaft für Ihre Arbeit?
Literaturwissenschaft liefert das methodische und begriffliche Instrumentarium, um literarische Werke zu deuten. Ich finde jedoch nicht, dass dies zu den Aufgaben des Biographen gehört, denn der Gehalt jedes bedeutenden Kunstwerks geht weit über die Intention des Künstlers hinaus, und manche Bedeutungsschichten lassen sich erst nach Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten erschliessen. Der Biograph eines Schriftstellers muss stattdessen plausibel machen, wie Texte von einer solchen Bedeutungsfülle überhaupt entstehen können. Vor allem: wie entsteht radikal Neues? Wie entsteht das, was wir als «genial» wahrnehmen? Das kann nicht die Literaturwissenschaft allein beantworten, sie kann dazu allenfalls einen Beitrag leisten.
Kann man eigentlich eine Kafka-Biographie ohne «psychoanalytische Fernanalysen über eine historische Kluft von mehr als einem Jahrhundert» schreiben, wie Sie es von sich einfordern?
Eine schwierige Frage. Ihr habe ich im zuletzt erschienenen Band über Kafkas frühe Jahre ein eigenes Kapitel gewidmet.
Sie sagten, dass Sie die Biographik als Disziplin verstehen, die viele Diskurse überblendet. Steht es dem nicht entgegen, wenn Sie psychologische Fragen auf diese Weise isolieren?
So ist es. Aber wenn ich 2000 Seiten über Kafka schreibe, muss die Psychoanalyse ins Spiel kommen, muss ich irgendwo sagen, ob sie etwas zum Verständnis Kafkas beitragen kann oder nicht, oder ob es vielleicht noch andere psychologische Theorien gibt, die uns hier weiterhelfen – wobei ich vor allem an die in den 40er Jahren begründete Bindungstheorie denke. Es ist jedoch unmöglich, über diese Theorien zu sprechen, ohne die entsprechende fachliche Terminologie zu verwenden. Also habe ich das ausgelagert, auch wenn das punktuell gegen mein Konzept ging. Man kann das überblättern, aber Lesern mit psychologischen Vorkenntnissen würde ich davon abraten.
Also würden Sie trotz Vorbehalten sagen, dass es unmöglich ist, eine Biographie ohne psychologische Ferndiagnosen zu schreiben?
Ich kann mich ja nicht dumm stellen. Ich sehe, dass Kafka Verhaltensweisen zeigte, die man als zwangsneurotisch charakterisieren muss. Ich sehe auch, dass er keinerlei Vertrauen in soziale Beziehungen hatte. Er nervte damit etliche Leute, vor allem Frauen, denen er andauernd Vertrauensbekundungen abverlangte. Bekam er von Felice Bauer mal einige Tage keinen Brief, glaubte er sofort, alles sei zu Ende. Er war eben sehr verwund- und kränkbar. Und wenn nun die Bindungstheorie genau dieses Verhalten als typisch für Menschen beschreibt, die als Kleinkinder keine konstanten Beziehungen hatten – das war ja bei den Kafkas der Fall, wo die Eltern immerzu abwesend waren –, dann finde ich das interessant genug, um es den Lesern mitzuteilen, auch dann, wenn sie ein wenig Fachvokabular in Kauf nehmen müssen.
Sind Sie mit solchen Annahmen näher dran an der empathischen Illusion der Romanciers oder an der empathischen Leistung des Biographen?
Das ist die entscheidende Frage, denn der Romancier ist im Leben seiner Figuren «dabei», der Biograph jedoch nicht. Als mein erster Band herauskam, fand ich das ein tolles Lob: «Mensch, das liest sich, als seien Sie dabei gewesen.» Beim zweiten Band wurde es mir mulmig. Es ist ein gefährliches Lob – vielleicht habe ich die Leser ja auch einfach nur eingelullt, oder gar mich selbst? Um dem vorzubeugen, lege ich es offen, wenn ich mutmasse oder etwas nicht belegen kann, im steten Bewusstsein, dass ich eben doch nicht dabei war. Aber auch bei grösster Vorsicht gibt es keine Garantie dafür, dass ich die Mosaiksteine richtig zusammengesetzt habe. Einige wichtige könnten immer noch fehlen – darum warte ich auch mit einer gewissen Spannung darauf, dass der Nachlass von Max Brod endlich zugänglich wird.
Können Sie ruhig schlafen ob der Aussicht auf ganz neue Kafka-Dokumente?
Ich bin sicher, dass mein Kafka-Bild dadurch nicht auf den Kopf gestellt wird. Es wird aber gewiss kleinere Überraschungen geben, etwa was die Interessen und das Auftreten des jungen Kafka betrifft. So gibt es zum Beispiel in diesem Nachlass einen Umschlag, auf dem steht: «Viel über Kafka», und in diesem Umschlag befindet sich ein kleiner Stapel von Notizbüchern des ganz jungen Brod. Ich habe viel Geld geboten, um nach Tel Aviv kommen und diese Notizbücher lesen zu können. Nicht kopieren oder mitnehmen, nur lesen. Aber die Erbin erlaubte es mir nicht. Das war natürlich bitter – obwohl ich nicht glauben kann, dort Dinge zu finden, die alle meine Vermutungen widerlegen. Andererseits kenne ich die weissen Flecken meiner Bücher sehr genau und habe die Hoffnung noch keineswegs aufgegeben, einige von ihnen zu füllen.
Dass Sie dazu auf eine «windige Gestalt» angewiesen sein werden, der Sie Bedeutungslosigkeit in Sachen Kafka-Forschung bescheinigen, ist ja eine ziemliche Pointe.
Als unmittelbarer Augenzeuge ist Brod natürlich bedeutsam. Seine späteren Stilisierungen und Verdrehungen sind es weniger.
Dann sind Sie also noch lange nicht fertig mit «Ihrem» Kafka?
Aber nein! Nur habe ich momentan genug zu tun mit der Rezeption der Biographie: die Übersetzungen, Anfragen von Schulen, Universitäten und Theatern. Und nun wird die Biographie auch noch verfilmt, in Form einer achtteiligen TV-Serie.
Können Sie Details erzählen?
Noch nicht allzu viele. Der ORF und das tschechische TV sind dabei, mit weiteren Sendern wird verhandelt. Wir drehen in Deutsch, Tschechisch und vielleicht auch Jiddisch. Von den acht Folgen existieren bereits zwei Drehbücher, die weiteren Skripte werden entstehen, sobald die Finanzierung gesichert ist. Ich freue mich sehr, als Berater dabei zu sein. Wenn alles nach Plan geht, wird 2019 gedreht. Wobei das entscheidende Problem sein wird: Wie zeigen wir Kafka als Autor in Aktion, im kreativen Rausch? Bei einem Komponisten ist das viel einfacher zu vermitteln. Aber Handschriftliches zu verfassen, das ist ja für die grosse Mehrzahl der Zuschauer eine eher unattraktive Arbeit. Wie setzt man das in einem «Biopic» filmisch um? Die Zeit der Kostümfilme, als man sich darauf kaprizierte, eine übers Pergament rasende Feder abzufilmen, ist ja nun definitiv vorbei. Da finde ich zum Beispiel die Sherlock-Holmes-Serie mit Benedict Cumberbatch schon überzeugender. Wenn Holmes dort vom Schreiben absorbiert ist, sieht man ihn in einer sich verdichtenden Wolke von Worten und Buchstaben. Das gefällt mir, auch wenn das vielleicht noch immer zu harmlos ist.
Wer kommt überhaupt auf die Idee, ein so anspruchs- und widerspruchsvolles Leben zu verfilmen?
Den Anfang machte eine österreichische Produktionsfirma, bei der offenbar meine Kafka-Biographie gelandet war und wo man feststellte, dass hier schon vieles gleichsam filmisch erzählt ist. Dann wurde ihnen bewusst, dass es bisher kaum filmische Versuche der Annäherung an Kafka gegeben hat, und das, obwohl er eine weltweit bekannte kulturelle Leitfigur ist. Vermutlich hängt das mit dem Vorurteil zusammen, dass Kafkas Leben uninteressant war, dass er es im wesentlichen am Schreibtisch verbracht hat. Wenn man erst einmal verstanden hat, wie falsch diese Vorstellung ist, liegt die Idee nahe, es einmal mit den neuen ästhetischen Mitteln der TV-Serie zu versuchen, um ein realistischeres Bild zu schaffen.
Was ist das Aufregendste an der Verfilmung?
Die breite, explosive Wirkung, die man mit einem biographischen Film erzielen kann. Meine Biographie lesen im deutschen Sprachraum vielleicht 30 000 Leute, weltweit doppelt so viele, den Film aber schauen möglicherweise Millionen. Der Film hat erheblichen Einfluss darauf, welche Bilder diese vielen Menschen mit Kafka assoziieren werden. Das bedeutet eine so grosse Verantwortung, dass die Aufregung sich ganz von allein einstellt. Ich denke, auch der sehr erfahrene Drehbuchautor wird dem nicht entgehen, von den Schauspielern ganz zu schweigen.
Eine letzte Frage: würden Sie ein Werk von Kafka mit auf die einsame Insel nehmen?
Nein. Auf gar keinen Fall. Kafka kenne ich viel zu gut.
Reiner Stach
ist Literaturwissenschafter, Autor einer preisgekrönten Kafka-Biographie und Publizist. Er lebt in Berlin.
Gregor Szyndler
ist Redaktor dieser Zeitschrift.