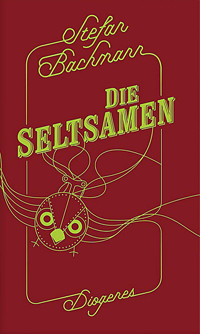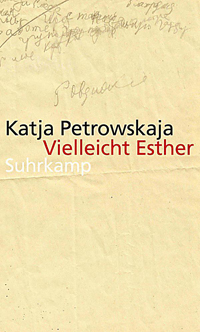Literatur und Wissenschaft
Goethe tat es, Zola, Flaubert und auch Musil: eine kurze Geschichte der Auseinandersetzung von Schriftstellern mit ihrem Metier, den Grenzen zur und den Gemeinsamkeiten mit der Wissenschaft vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart.
Literatur beschäftigt sich mit erfundenen Welten, Personen und Sachverhalten, Wissenschaft versucht die unsichtbaren Grundlagen der realen Welt freizulegen. Ein literarischer Text gilt dann als besonders gelungen, wenn er seine Leserinnen und Leser durch ungewöhnliche Sehweisen und Darstellungsformen fesselt, der Wert einer wissenschaftlichen Arbeit bemisst sich an der in ihr enthaltenen überprüfbaren Erkenntnis. Man könnte zahlreiche weitere Unterschiede zwischen Literatur und Wissenschaft aufführen, etwa im Hinblick auf die technischen Verfahren, den Grad der Institutionalisierung, die Finanzierung und das Sozialprestige der beteiligten Akteure. All dies liefe auf die Feststellung hinaus, dass kaum ein grösserer Gegensatz denkbar ist als der zwischen Literatur und Wissenschaft. Dieser Gegensatz liesse sich aus einer seit etwa 250 Jahren anhaltenden gesamtgesellschaftlichen Entwicklung heraus erklären, welche der Soziologe Niklas Luhmann als funktionale Ausdifferenzierung bezeichnet. Demzufolge ist die moderne Gesellschaft dadurch gekennzeichnet, dass sie aus autonomen Teilsystemen besteht, die je unterschiedliche Funktionen übernehmen: Wirtschaft, Recht, Politik, Kunst, Wissenschaft, Religion. Diese Systeme sind, so Luhmann, operativ geschlossen und unterliegen einer je spezifischen Codierung. Folgt man dieser Logik, so kann es zwischen Literatur und Wissenschaft keinen relevanten Zusammenhang geben, denn es handelt sich ja um verschiedene soziale Systeme.
Nun stellt man jedoch fest, dass es seit dem späten 18. Jahrhundert zahlreiche literarische Texte gibt, die nicht nur in punktueller und anekdotischer, sondern in programmatischer Art und Weise auf Wissenschaft Bezug nehmen. Einige dieser Texte sollen im folgenden kurz betrachtet werden, mit dem Ziel, Aufschlüsse über das Verhältnis zwischen Literatur und Wissenschaft in der Moderne zu gewinnen. Dabei sind grundsätzlich drei Ebenen zu unterscheiden: die dargestellte Handlung, die Darstellung und die poetologische Selbstreflexion. Es werden hier Texte betrachtet, auf deren Handlungsebene Bezugnahmen auf Wissenschaft erfolgen, etwa indem Wissenschafter als Protagonisten erscheinen oder indem wissenschaftliche Theorien von den Protagonisten betrachtet oder diskutiert werden. In diesen Texten hat die Bezugnahme auf Wissenschaft darüber hinaus auch eine Auswirkung auf die Darstellungsebene, indem wissenschaftliche Sprache aufgegriffen wird. Schliesslich nutzen diese Texte die Bezugnahme auf Wissenschaft auch zu poetologischen Zwecken, indem sie sich ihrer eigenen Grundlagen und Bedingungen vergewissern. Wissenschaft erscheint dergestalt in drei verschiedenen Formen und Funktionen: als Thema bzw. Gegenstand, als sprachliches Modell und als metaphorische Reflexionsfigur.
Kalkerde und «zarte Säure»
Beginnen wir mit Goethes Roman «Die Wahlverwandtschaften» (1809). Wie der Autor, der bekanntlich ein umfassend gebildeter Naturforscher war, in einer im «Morgenblatt für gebildete Stände» erschienenen Selbstanzeige schreibt, ist es Ziel dieses Romans, «eine chemische Gleichnisrede zu ihrem geistigen Ursprunge» zurückzuführen. Der Titel des Romans greift einen Fachbegriff der Chemie auf. Dieser Begriff ist metaphorisch, da er eine Beziehung aus dem Bereich der menschlichen Gesellschaft in den Bereich der chemischen Elemente überträgt. Der Hauptmann, einer der vier Protagonisten des Romans, erläutert im vierten Kapitel des ersten Teils die Verwendungsweise des titelgebenden Begriffs anhand des Kalksteins, der aus einer Verbindung von Kalkerde und einer «zarten Säure» entstehe. Wird nun der Kalkstein mit verdünnter Schwefelsäure in Berührung gebracht, so verbindet sich die Schwefelsäure mit dem Kalk «und erscheint mit ihm als Gips», während die zuvor mit der Kalkerde verbundene Säure freigesetzt wird. «Hier ist eine Trennung, eine neue Zusammensetzung entstanden, und man glaubt sich nunmehr berechtigt, sogar das Wort Wahlverwandtschaft anzuwenden, weil es wirklich aussieht, als wenn ein Verhältnis dem andern vorgezogen, eins vor dem andern erwählt würde.» Auf der Handlungsebene von Goethes Roman wird nun die Richtung der metaphorischen Übertragung umgekehrt, indem der chemische Fachbegriff seinerseits als Metapher für die Beziehungskonstellation zwischen den Protagonisten verwendet wird. So sagt Eduard zu seiner Frau Charlotte: «Gesteh nur deine Schalkheit! Am Ende bin ich in deinen Augen der Kalk, der vom Hauptmann, als einer Schwefelsäure ergriffen, deiner anmutigen Gesellschaft entzogen und in einen refraktären Gips verwandelt wird.» Die Übertragung der «chemischen Gleichnisrede» auf das Verhältnis zwischen den Romanfiguren geht indes nicht auf: Die komplexe Beziehungskonstellation zwischen Eduard, Charlotte, dem Hauptmann und Ottilie entspricht nicht exakt dem chemischen Begriff, insofern sich die vier Personen zwar zu zwei neuen Paaren zusammenfügen, allerdings nicht, wie es das chemische Modell der doppelten Wahlverwandtschaft erfordert, durch die Auflösung zweier zuvor schon vorhandener Paare. Die scheinbar so überzeugende und zwingende, in Wirklichkeit aber scheiternde Rückübertragung des metaphorischen chemischen Fachbegriffs auf die Sphäre menschlicher Beziehungen macht somit eine grundlegende Diskrepanz zwischen Wissenschaft und Literatur sichtbar. Goethes Roman lässt durchaus ein Bewusstsein für diese Diskrepanz erkennen, etwa wenn der Hauptmann, der die chemische Gleichnisrede einführt und erläutert, eingesteht, dass sein diesbezügliches Wissen bereits veraltet sein könne. Dadurch wird angezeigt, dass etwas, das im Bereich der Wissenschaft nicht mehr relevant ist, im Bereich des Ästhetischen dazu dienen kann, ungelöste Pro-bleme zu reflektieren; genau dies ist Karl Eibl zufolge die Funktion der Literatur in der Moderne (vgl. sein Buch «Die Entstehung der Poesie», Suhrkamp, 1995). Indem nun aber ein Text wie Goethes «Wahlverwandtschaften» wissenschaftliche Diskurselemente auf der Ebene der Handlung und auf der Ebene der Darstellung zum Einsatz bringt und dadurch zeigt, dass die Literatur ungelöste Probleme reflektiert, werden diese Elemente zu poetologischen Allegorien, in denen sich eine Reflexion des literarischen Textes auf seinen eigenen Stellenwert verbirgt.
Comédie humaine
In diesem Sinne kann man auch das Balzac’sche Projekt der Comédie humaine verstehen. Im 1842 erschienenen «Avant-propos» zu seinem Romanzyklus versucht Balzac sein Projekt einer umfassenden Gesellschaftsdarstellung wissenschaftlich zu fundieren und den Roman damit als Kunstform aufzuwerten. Als Leitidee dient ihm die Gleichsetzung von Menschenwelt und Tierwelt, welche auf dem Prinzip der Einheit der Schöpfung beruht. «Macht nicht die Gesellschaft aus dem Menschen, entsprechend den Milieus, in denen er seine Aktivitäten entfaltet, ebenso viele verschiedene Menschen, wie es zoologische Arten gibt?» Balzac orientiert sich an den Arbeiten von Naturwissenschaftern wie Cuvier und Geoffroy Saint-Hilaire und sagt: «Wenn Buffon ein grossartiges Werk geschaffen hat, indem er versuchte, in einem Buch die Gesamtheit der Zoologie darzustellen, müsste man dann nicht ein Werk ebendieser Art für die Gesellschaft herstellen?» Das impliziert die Gleichsetzung des Romanautors mit dem Wissenschafter und die Modellfunktion wissenschaftlichen Denkens und wissenschaftlicher Darstellungsweisen für die Literatur. Eine solche Gleichsetzung finden wir auch bei Zola, der in seiner Programmschrift «Le roman expérimental» (1880) schreibt: «[…] ich möchte mich in allen Punkten hinter Claude Bernard verschanzen. Sehr häufig wird es ausreichen, wenn ich das Wort ‹Arzt› durch das Wort ‹Romanautor› ersetze, um mein Denken verständlich zu machen und ihm die Strenge einer naturwissenschaftlichen Wahrheit zu verleihen.» Zola, der in Anlehnung an die von Claude Bernard verfasste «Introduction à l’étude de la médecine expérimentale» (Baillière, 1865) vom roman expérimental spricht, sieht sich selbst als Vollender des von Balzac erstmals definierten, aber Zolas Auffassung nach nicht konsequent umgesetzten Projekts eines auf wissenschaftlichen Prinzipien beruhenden Romans.
Ebenso wie bei Goethe geht die scheinbar perfekte Gleichsetzung von Literatur und Wissenschaft indes auch bei Balzac und Zola nicht bruchlos auf. Was auf der Ebene der Theorie postuliert wird, das lösen die Romane nur zum Teil ein. So bricht sich etwa in Balzacs «La peau de chagrin» (Gosselin et Urbain Canel, 1831) die Fortschritts- und Wissenschaftsgläubigkeit des 19. Jahrhunderts, von der auch der Autor erfasst war, an einem rätselhaften Objekt, der titelgebenden magischen Eselshaut, deren Geheimnis weder durch den Zoologen noch durch den Mechaniker und den Chemiker gelüftet werden kann. Ausserdem werden in diesem Roman die Grenzen zwischen Wissenschaft und Literatur unscharf, indem der Naturwissenschafter Cuvier als «der grösste Dichter unseres Jahrhunderts» bezeichnet wird, der es vermag, die tote Materie zum Leben zu erwecken. In ähnlicher Weise wird in Zolas «Le docteur Pascal» (Charpentier, 1893), dem abschliessenden Roman des auf den Prinzipien der Vererbungslehre seiner Zeit beruhenden Zyklus «Les Rougon-Macquart», die Allianz von Wissenschafter und Dichter als Grenzüberschreitung im Zeichen der Imagination inszeniert: «Ah! Diese Wissenschaften in ihrem Anfangsstadium, diese Wissenschaften, in denen die Hypothesen gestottert werden und die Imagination das Sagen hat, sie gehören den Dichtern nicht weniger als den Wissenschaftern! Die Dichter sind die Pioniere, sie bilden die Vorhut, entdecken oftmals jungfräuliche Landschaften und weisen auf naheliegende Lösungen hin.» Man kann somit festhalten, dass Balzac und Zola auf der Ebene der offiziellen Romanpoetik die Wissenschaft zum normativen Modell erheben und damit dem Roman eine erhöhte Dignität zuzuschreiben versuchen. In der literarischen Praxis kann die Wissenschaft als Gegenstand auf der Ebene der erzählten Handlung erscheinen und die Dominanz wissenschaftlichen Denkens illustrieren. Sie kann als Quelle der inventio dienen, indem Geschichten erzählt werden, in denen Wissenschafter eine wichtige Rolle spielen. Sie kann dabei aber auch zum Gegenstand epistemologischer Kritik werden, durch welche die Grenzen wissenschaftlicher Erkenntnis aufgezeigt werden. Schliesslich dient die Bezugnahme auf Wissenschaft als Vehikel poetologischer Selbstreflexion, etwa wenn der Arzt Pascal zur Allegorie des Erzählers der Rougon-Macquart wird, indem er in Form einer mise en abyme die wichtigsten Handlungen der anderen Romane des Zyklus noch einmal erzählt oder indem von Balzac wie von Zola die Analogien zwischen dem Wissenschafter und dem Dichter betont werden.
Das 20. Jahrhundert
Im 20. Jahrhundert gerät das von Goethe, Balzac, Zola und anderen wichtigen Autoren des 19. Jahrhunderts entwickelte und umgesetzte Projekt eines wirklichkeitsdarstellenden Romans zunehmend in die Krise, wodurch sich auch das Verhältnis zwischen Roman und Wissenschaft ändert. Ein wichtiger Vorläufer dieser Entwicklung ist Flaubert, der in seinem letzten, unvollendet gebliebenen Roman «Bouvard et Pécuchet» (1880) die Wissenschaftsgläubigkeit seiner Epoche mit ironischer Distanz parodiert, indem er seine beiden Protagonisten auf eine enzyklopädische Reise durch alle Bereiche der Wissenschaften schickt und sie jedesmal scheitern lässt, wobei das Scheitern teilweise auf der naiven Gläubigkeit und Unerfahrenheit der Protagonisten beruht, teilweise aber auch auf den internen Widersprüchen der wissenschaftlichen Disziplinen. An der von Flaubert aufgezeigten Aporie, die darin besteht, dass die Wissenschaft unvollkommen und zugleich unhintergehbar ist, setzen wichtige Autoren des 20. Jahrhunderts wie Musil, Borges und Calvino an, indem sie je unterschiedliche ästhetische Möglichkeiten entwickeln, um mit dieser Aporie umzugehen. Am Beispiel von Musils «Mann ohne Eigenschaften» (Bd. 1: Rowohlt, 1930; Bd. 2: Rowohlt, 1933; Bd. 3: Rowohlt, 1943) sei dies hier abschliessend kurz demonstriert. Dieser unvollendete Roman, an dem der Autor bis zu seinem Tod 1942 weiterarbeitete, erzählt die Geschichte eines Mannes, Ulrich, der vor Beginn der eigentlichen Handlung schon drei Lebensentwürfe ausprobiert und drei Berufe erlernt hat: den des Offiziers, des Ingenieurs und des Mathematikers. Als Mathematiker huldigt er dem für die moderne Wissenschaft charakteristischen Ideal der Exaktheit und des Hypothetischen, der permanenten Selbstaufhebung und Selbstüberschreitung. Dies führt dazu, dass er paradoxerweise auch diesen dritten von ihm erlernten Beruf schliesslich wieder aufgibt, um sich eine einjährige Auszeit vom Leben zu nehmen. Die Überfülle von realisierbaren Möglichkeiten schlägt bei Ulrich somit in einen Mangel um, den Musil auf den Begriff der Eigenschaftslosigkeit bringt. Aus der Leerstelle dieser Unbestimmtheit generiert Musil seinen Roman, der die Auseinandersetzung mit den Erkenntnissen der modernen Wissenschaft nicht auf die Figurenebene beschränkt, sondern darüber hinaus auch auf der Ebene des Erzählerdiskurses – zumeist in ironischer Distanzierung – zur Anwendung bringt. Die Erzählweise des Romans ist dadurch gekennzeichnet, dass die eigentlich zu erzählende Geschichte an den Rand gedrängt wird, indem der Erzähler weit ausgreifende Kommentare, Reflexionen und philosophisch-wissenschaftliche Analysen einfliessen lässt, die den Text quantitativ dominieren und zu der erzählten Geschichte in einem Verhältnis perspektivischer Brechung stehen. Diese Erzählweise bringt Musil auf den poetologischen Begriff des Essayismus, welcher wiederum in einem Analogieverhältnis zu Ulrichs Selbstexperiment steht: «Ungefähr wie ein Essay in der Folge seiner Abschnitte ein Ding von vielen Seiten nimmt, ohne es ganz zu erfassen – denn ein ganz erfasstes Ding verliert mit einem Male seinen Umfang und schmilzt zu einem Begriff ein –, glaubte er, Welt und eigenes Leben am richtigsten ansehen und behandeln zu können.» Insofern hat das wissenschaftliche Denken auch in diesem Roman eine fundamentale poetologische Bedeutung. Wenn der Wissenschafter Ulrich, der die Wissenschaft als Beruf hinter sich gelassen hat, versucht, in dem an sich selbst vollzogenen Experiment ein Mensch zu werden, «in dem eine paradoxe Verbindung von Genauigkeit und Unbestimmtheit stattfindet», dann kann man dies auch als Selbstbeschreibung von Musils Romanexperiment lesen.
Die hier untersuchten Texte von Goethe, Balzac, Zola, Flaubert und Musil stehen exemplarisch für eine wichtige Entwicklungslinie des Romans im 19. und 20. Jahrhundert, die durch programmatische Bezugnahmen auf Wissenschaft charakterisiert ist. Wie skizzenhaft gezeigt werden konnte, sind diese Bezugnahmen auf verschiedenen Ebenen nachweisbar und haben mehrere Funktionen. Vor dem Hintergrund der eingangs erwähnten funktionalen Ausdifferenzierung und des damit implizierten Auseinanderdriftens von Literatur und Wissenschaft lassen diese Befunde den Schluss zu, dass die Literatur sich durch programmatische Bezugnahmen auf Wissenschaft ihrer eigenen Identität versichert und zugleich einen kritischen Beitrag zur Geschichte des Wissens liefert.