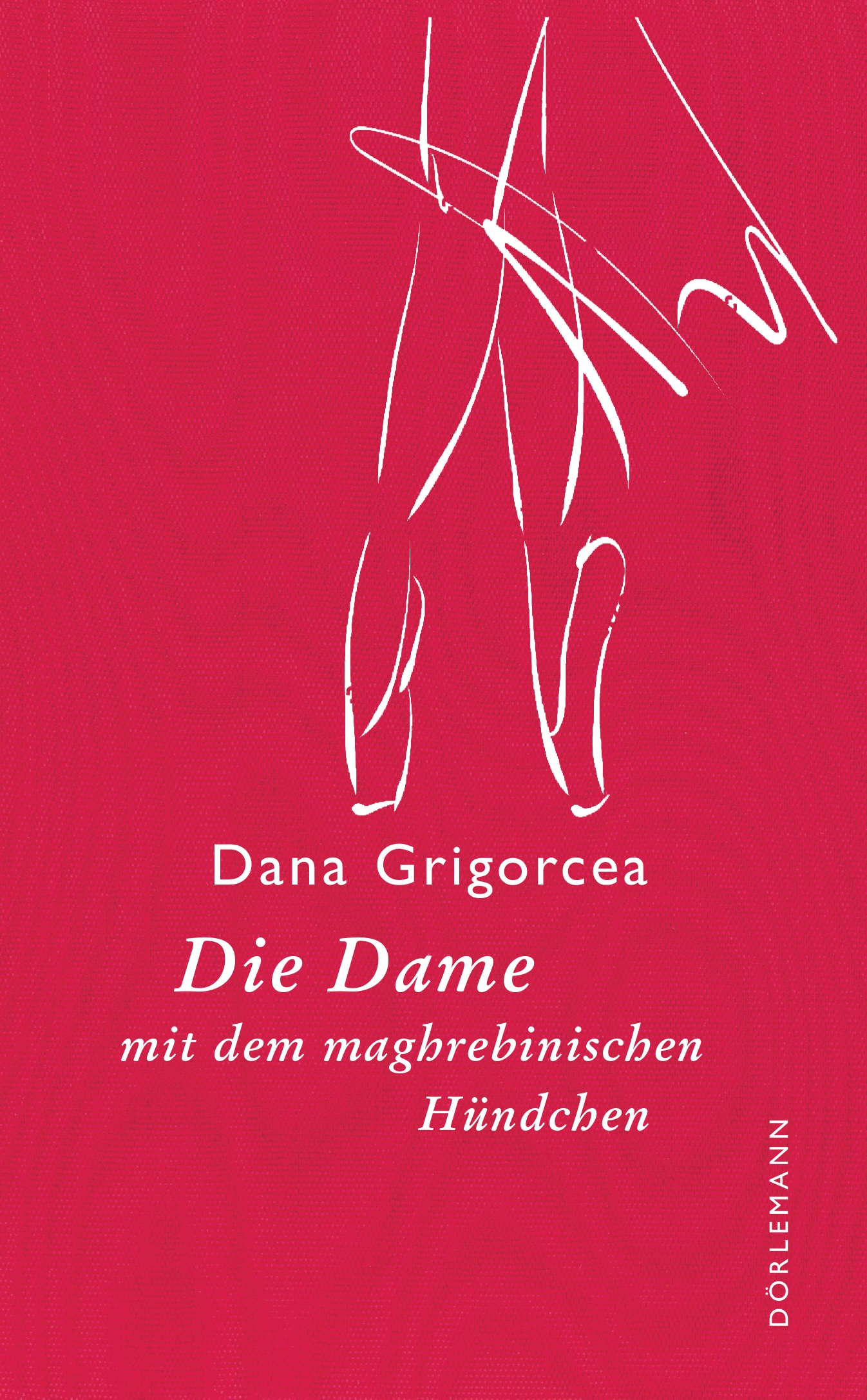Reine Fakten sind eine Fiktion
In seinem Tagebuchroman «Der Innerschweizer» provoziert eine Basler Studenten-WG eine kriegerische Invasion der Sowjetunion am Rheinknie. Hier erklärt der Historiker und Schriftsteller Urs Zürcher, wie er der Denkunmöglichkeit «Krieg in der Schweiz» ein literarisches Schnippchen schlug.
Denken wir hierzulande «Krieg» und «Schweiz» zusammen, bilden sich folgende oder ähnliche Verbindungen:
Das liegt sehr lange zurück.
Rundherum gibt’s Krieg.
Die Schweiz profitiert vom Krieg.
Die Schweiz nimmt Kriegsflüchtlinge auf.
Die Verbindung «Es gibt Krieg in der Schweiz» will dabei nicht entstehen, da klemmt’s im Gehirn, ein Knoten vielleicht. Oder eine Fehlschaltung. Der Gedanke kommt gar nicht erst
zustande. Um ihn zu stimulieren, benötigen wir den Konjunktiv: Was wäre, wenn…? Diese Frage setzt ein Spiel mit der Realität in Gang. Ist diese Realität historisch, sprechen wir von kontrafaktischer Geschichtsschreibung, ein Grau- oder Grenzbereich innerhalb der Geschichtswissenschaften. Grammatikalisch aber führt uns die Frage in die unendlichen Weiten des Irrealis, in die Undenkbarkeit oder anders gesagt: in die Literatur.
Wieso soll ich «Krieg in der Schweiz» aber überhaupt denkbar machen? Führt das irgendwohin? Ja, durchaus: das Undenkbare an das Denkbare heranführen ist zunächst eine Erprobung der Realität, eine Art Realitäts-TÜV. Die verbriefte Realität, auch historische Wahrheit oder ganz einfach nur Wirklichkeit genannt, wird gewissermassen auf die Bühne gezerrt, ins Scheinwerferlicht gerückt, wo sie sich bewähren muss. Denn jetzt beginnt das Stück: An der Realität wird herumgefummelt, sie verliert da einen Hut, dort ein Bein, hier wird an ihr herumgeflickt, dort was übergestülpt. Und allmählich steht sie da in neuem Kleid und neuer Form. Ist die Aufführung gelungen, kann sie sich sehen lassen und muss den Vergleich mit der ursprünglichen Wirklichkeit nicht scheuen. Das Denkbare hat sich etwas ausgedehnt, indem es sich selber ausgekundschaftet, seine Ränder besichtigt und Ausschau gehalten hat ins Reich jenseits seiner Grenze, dort, wo die Unwahrscheinlichkeiten schlummern.
Der Irrealis spiegelt die Wirklichkeit an ihren Möglichkeiten. Das heisst, was wir Wirklichkeit nennen, ist nur eine ihrer Möglichkeiten, oder, anders gesagt, die Wirklichkeit ist das, was von den Möglichkeiten übrigbleibt, das, was Menschen aus den Möglichkeiten herausgeschält haben. Was geschieht, ist weder notwendig noch nötig. Das ist kein neuer Gedanke, er stammt aus der Zeit der Aufklärung.
«Krieg in der Schweiz» ist eine Inszenierung der Wirklichkeit auf der Bühne der Literatur. Einerseits ein Instrument zur Erkundung und Reflexion dessen, was Realität genannt wird, zum anderen eine Ode an den Konjunktiv, der mehr ist als ein Modus des Verbs, mehr als ein Schatten des Tatsächlichen, nämlich eine der grundlegenden Antriebskräfte menschlichen Daseins. Einen Menschen nur im Tatsächlichen und Wirklichen kann ich mir nicht vorstellen. So ein Mensch ist im eigentlichen Sinn undenkbar. Der Mensch tickt konjunktivisch. Mit anderen Worten: der Mensch ist ein poetisches Wesen. Jeden Tag ist nicht nur das tatsächlich Erlebte und Getane unser Lohn und Glück, es sind auch die Räume zwischen den Wahrscheinlich- und Tatsächlichkeiten, die uns treiben und beschäftigen, all die verpassten und erhofften Chancen, all die verrückten Begierden, Möglichkeiten und Irrealitäten, all das sind Elemente unserer Ontologie. Und wenn jemand kommt und sagt, das sei alles Mist, das sei alles Einbildung und billige Phantasie, geistiger Tingeltangel, dann sollte man ganz gelassen entgegnen: Das sind bloss unsere eigenen Gedanken, die gerade einen Auftritt haben.
Die Erprobung einer Undenkbarkeit emanzipiert den Konjunktiv von der unendlichen Masse von Fakten, von News und Realitäten, die auf ihm lasten. Damit wird die Grenze zwischen dem Tatsächlichen und dem Möglichen in Frage gestellt oder vielmehr: sie wird als Illusion entlarvt. Und diese Illusion ist der Tanzboden der Literatur. Auf dieser Bühne spielt die Literatur immer wieder dasselbe Stück: «Reine Fakten sind eine Fiktion.»
Etwas als undenkbar zu beschreiben kann zwar einen wahren Sachverhalt bezeichnen («ein viereckiger Kreis ist undenkbar»), wird aber allzu oft als imperative Eingrenzung der tatsächlichen Verhältnisse eingesetzt, als Einfriedung des Gegebenen und Gewünschten und soll wie eine Firewall vor unwillkommenen Denkströmen schützen. Eine Denkbarmachung bedeutet, der Verarmung des Realitätsbegriffs etwas entgegenzuhalten, indem die Denkzone ausgeweitet wird, oder anders formuliert: eine Poetisierung der strammen Realität. Etwas als undenkbar zu beschreiben heisst, den Sprachschatz nicht zu heben.
Es gibt also Gründe für eine Inszenierung der Wirklichkeit – und also auch für eine Denkbarmachung von «Krieg in der Schweiz». Doch wie kann das Ferne wahrscheinlich gemacht werden? In welcher Sprache, in welchem Modus kann die Undenkbarkeit in die Nähe des Denkbaren gerückt werden?
Eine Möglichkeit ist die Dehnung, die Zerstückelung der Denkunmöglichkeit in Einheiten des Denkbaren. Victor Klemperers Tagebuch 1933–1945 ist ein herausragendes Beispiel einer solchen Zerstückelung des Undenkbaren in denkbare und damit nachvollziehbare Schritte.1 Tag für Tag hält Klemperer die Details des nationalsozialistischen Alltags fest, ihre Wirkung auf die Menschen und beschreibt Vorgänge, die in ihrer Gesamtheit tatsächlich undenkbar waren, durch die Aufteilung in tausende Einzelbeobachtungen aber denkbar, für uns Lesende zugänglich werden. Klemperer ist ein Chronist des Alltags, das Ende der Entwicklung konnte er nicht einmal ahnen und ist deshalb immer wieder erstaunt, dass die Realität stets aufs neue undenkbares Terrain beschreitet. Es gibt allerdings Augenblicke, da formt sich mit Blick auf seine Tagebucheinträge eine Linearität, die ihn ebenso erschreckt wie erstaunt: «Sie werden uns alle töten.»
Die Tagebuchform zerteilt einerseits die Wirklichkeit in räumlicher Hinsicht, indem das Grosse in Form von denkbaren Bruchstücken abgebildet bzw. nachgebildet wird, zum anderen wird die Geschwindigkeit, mit der das Grosse in der Sprache eines Lexikons festgehalten wird (z.B. «Krieg in der Schweiz»), verlangsamt, zeitlich gedehnt, dem Lesenden in Slow Motion vor Augen geführt, was ja auch dem nichtlinearen Zeitempfinden entspricht, das Tage so leer oder so voll erscheinen lässt, epochale Minuten ermöglicht oder unbelebte Jahre. Man kann dem Grossen folgen, es wird Teil der unübersichtlichen Anzahl alltäglicher Einzelheiten, die niemals lexikalisch werden. Insofern ist das Tagebuch das Gegenteil eines Lexikons.
So wie Klemperer die Realität nachzeichnet und derart Tag für Tag an einem Gemälde des Denkbaren arbeitet (woran er während des Schreibens allerdings nie denkt), so ermöglicht es die Form des Tagebuchs auch literarisch, in fiktiver Form, das Undenkbare glaubhaft – denkbar zu machen. Und wenn nach der Lektüre der Gedanke nicht fern ist: «Ja, so hätte es auch gewesen sein können. Das ist nicht abwegig. Das kann man sich ja denken», dann ist die Aufführung gelungen. Im Gegensatz zu einem realen Tagebuch wie jenem von Victor Klemperer, bei dem Autor und Erzähler zusammenfallen, hat ein fiktives Tagebuch einen ambivalenten Charakter. Zum einen evoziert die Tagebuchform «Authentizität»; es gibt in der Regel keinen Adressaten, keine Dramaturgie; das einzige Publikum des Textes ist der Diarist bzw. der Erzähler selbst. Ist ein bewusster Gestaltungswille nicht ersichtlich, gilt der Text als «authentisch», also «nichtliterarisch». Anderseits macht die Gattungsbezeichnung «Roman» klar, dass dies alles erfunden ist, die Authentizität nur vorgetäuscht, fingiert. Das Ungestaltete ist gestaltet. Zwei Genres, die zunächst unvereinbar scheinen, kommen in Konflikt und bauen eine Spannung auf, die den Text trägt und Raum öffnet für das Spiel mit der Realität: Was wäre, wenn…?
Erst allmählich erschloss sich mir ein weiterer wichtiger Aspekt der Tagebuchform: Wie in kaum einem anderen Genre zeigt sich die Durchdringung des Kleinen durch das Grosse so exemplarisch wie in einem Tagebuch. In einem Tagebuch, das nicht mit Blick auf eine Publikation geschrieben wird (wie der «Innerschweizer» aus Sicht des Erzählers), werden Geschehnisse von welthistorischer Bedeutung zwanglos mit Beobachtungen und Gegebenheiten des Alltags zusammengeführt. Das möglicherweise bekannteste Beispiel stammt von Franz Kafka, der am 2. August 1914 notiert: «Deutschland hat Russland den Krieg erklärt. – Nachmittag Schwimmschule.»2 Das Tagebuch-Ich bewegt sich zwischen diesen beiden Polen und – vor allem – es ist von beiden gleichermassen durchdrungen, wird von beiden gleichermassen gesteuert und geprägt. Insofern vermag die Tagebuchform ohne theoretische Ausschweifungen sehr schön zu zeigen, wie sowohl ein globaler Megadiskurs als auch die alltäglichen Situationen den Menschen durchdringen, ihn infiltrieren und sich in ihm einlagern. Ein Tagebucheintrag protokolliert den Vorgang einer solchen Einlagerung, die bereits beim nächsten Eintrag absinkt, zum Sediment wird.
Die Welt, auch wenn sie noch so klein ist, wirkt über die Sprache auf das Tagebuch-Ich ein, gleichzeitig hat das Tagebuch-Ich mit der Sprache eine Möglichkeit, auf die Welt, und wenn sie noch so gross ist, einzuwirken. Sprache zerfliesst zu Welt und Welt zu Sprache. Das ist die Dialektik des Tagebuchschreibens und des Schreibens überhaupt.
Krieg ist keine Erfindung, «Krieg in der Schweiz» aber ist eine Fiktion.
1
Victor Klemperer: Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten.
Tagebücher 1933–1945. Berlin: Aufbau, 1995.
2
Franz Kafka: Tagebücher. Herausgegeben von Max Brod.
Frankfurt a.M.: S. Fischer, 1983. S. 305.