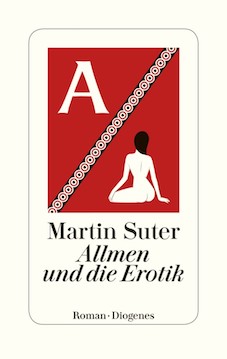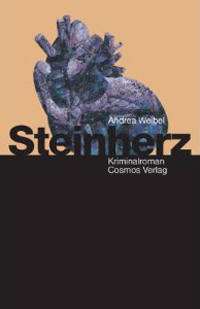Sommerloch
«Immer im Sommer versucht Larissa sich umzubringen.»
Immer im Sommer versucht Larissa sich umzubringen. Wenn die Tage länger und träger werden, die Hitze die Häuserdächer eindrückt und die ganze Stadt am See und im Wasser, in den Freibädern und auf den Dachterrassen ist, liegt Larissa zu Hause und versucht, die Langweile dieser Zeit bis aufs Blut zu bekämpfen.
Unter ihrem Fenster auf den Pflastersteinen der Altstadt schwirren die Tauben und entlaufenen Hunde, hinter den Schaufenstern stehen die alten Möbel; sie riecht ihren eigenen Schweiss. Worauf soll man sich im Sommer auch konzentrieren, denkt sie sich. Keine Schule, keine Menschen, kein gar nichts, was sie ablenken würde von diesem Loch in ihr drinnen, dort im Brustbereich. Sie fährt sich durch die kurzen Haare, vor dem Spiegel steckt sie sie mit ein, zwei Klammern zurück, verzieht eine Grimasse und schmeisst sich wieder aufs Bett.
Immer im Sommer versucht Larissa sich umzubringen, ohne dass die Mitbewohnerinnen es mitkriegen, ohne dass ihre Mutter währenddessen anruft und sie davon abhält, ohne dass sie dann doch ein paar Stunden später im Krankenhaus wieder aufwacht. Immer im Sommer, wenn die Tür hinter ihr ins Schloss fällt, sie durch die Küche in ihr Zimmer stolpert und ihre Tasche in die Ecke wirft, bleibt ihr Blick an der Nagelschere oder dem Rasierer, an anderen spitzen Gegenständen hängen und sie überlegt, ob heute wieder ein Tag ist, an dem sie es versucht.
Jetzt, kurz vor Einbruch der Dunkelheit, während niemand zu Hause ist, wägt sie ab, wann die anderen zurückkommen und ob morgen nicht doch ein Tag ist, den sie erleben möchte. Obschon sie weiss, dass auch morgen nur ein Tag sein wird, an dem sie in einem ihrer langen Röcke oder Kleider durch diese Kleinstadt gehen wird, sich vielleicht mit Freundinnen an den See setzen wird, nur um sich so schnell wie möglich ihrer Kleider zu entledigen und ins Wasser zu kommen: So schnell wie möglich, damit niemandem auffällt, dass ihre Schultern zu breit, ihre Oberarme zu fett sind. Dass sich ihre Haut unter der Sonne rot färbt und ihr Bauch viel zu weit hervorsteht. Darunter die Oberschenkel, die bei jedem Schritt hin und her schwappen.
Immer im Sommer versucht Larissa, die übrigens nicht dick ist, sich umzubringen. Wenn sie dasitzt zwischen den Freundinnen mit ihren langen Haaren und umwerfenden Lächeln und flachen Bäuchen, in Gespräche über Feminismus vertieft, sagt sie nichts, sondern fragt sich, was ihr eigentlich fehlt, um endlich zu sterben. Wenn die anderen sagen: aber du bist doch schön, denn alle sind schön, oder wenn sie sagen, dass Schönheit ein patriarchisches Konstrukt sei, dass sie sich nicht den Schönheitsidealen beugen sollte, sagt sie: Ja, ich weiss.
Aber das gilt für alle anderen, nicht für sie. Larissa kann jeden Menschen schön finden, nur sich selbst nicht. Wenn sie später durch die Secondhandläden streift und vor den anderen Menschen zurückschreckt, sich auf dem Nachhauseweg verläuft, weil sie auch nach zwei Jahren in dieser Stadt ständig die Orientierung verliert und bei jedem kleinen Geräusch zusammenzuckt, fragt sie sich, ob das Kleidungsstück, das sie sich gekauft hat, ein Gutes wäre, um darin zu sterben. Denkt an die Kleidungsstücke, die sie bereits verblutet hat, die dann von irgendwem – von wem eigentlich? – weggeworfen wurden, um nicht daran zu erinnern, wie sie blutend dalag, am Boden, beinahe tot, und wie sie dann dalag im Krankenwagen, ein bisschen lebendiger bereits, überlegt, ob es schade um die Kleidungsstücke war oder ob die eh egal sind.
Immer im Sommer vor den Kühlregalen im Supermarkt, die wenigstens etwas Abkühlung bieten, verschwindet Larissa für einen Moment zwischen den Milchkartons. Ihr Kopf hält kurz an und sie versucht sich vorzustellen, wie sie an der Kälte stirbt und dieses Mal nicht wieder aufwacht mit einem Menschen neben ihrem Bett, der ihre Hand hält mit diesem Gesichtsausdruck aus Enttäuschung und Mitleid.
Fick Mitleid. Larissa spuckt auf den Boden, bevor sie sich zu ihrer besten Freundin in den Park setzt und beide die Füsse in das flache Becken halten und die Sonne langsam verschwindet. Immer im Sommer, wenn sie dasitzen am frühen Abend und Larissa weint und sagt, sie sehe den Sinn nicht mehr, und ihre beste Freundin nach Worten sucht, während sie sich fragt, ob sie überhaupt befugt ist, etwas zu sagen: Inwiefern ein Mensch das Recht hat, einem anderen die Berechtigung zum Selbstmord abzusprechen, inwiefern ein Mensch tatsächlich das Leben eines anderen bejahen sollte ohne die Gewissheit, dass tatsächlich immer alles wieder besser wird, auch wenn das bei einem selber bis jetzt immer so war, und ob das Leben eines Menschen wirklich um jeden Preis erhalten werden sollte.
Immer dann, wenn Larissa sich die Tränen fortlaufend aus dem Gesicht streicht und ihre Stimme stockt und zittert und sie ihre Unterschenkel im Wasser betrachtet, die auch zu fett und zu wenig muskulös sind, denkt ihre beste Freundin, dass es an diesem Abend, in diesem Sommer vielleicht dieses Mal tatsächlich zu Ende geht. Zugegebenermassen hat Larissa immer noch mehr Sommer überlebt, als dass sie Sommer nicht überlebt hat, und nach einer gewissen Zeit verliert die Aussicht darauf, dass die beste Freundin sich das Leben nehmen könnte, ihre Dringlichkeit, wenn es dann oft genug nicht passiert ist oder halt nicht geklappt hat.
Immer im Sommer fragt sich Larissas beste Freundin, wie viel sie dafür tun sollte, dass Larissa sich nicht umbringt. Wie viel sie tun darf und wie schlimm es sein wird, sollte es Larissa doch einmal gelingen, oder ob sie das als Erlösung für Larissa und sich selbst wahrnähme.
Als Erlösung aus diesem ewigen Kreislauf, der sich über ein ganzes Jahr spannt, der seinen Tiefpunkt im Sommer hat, weil Larissa sich dann umbringen möchte. Der sich durch den Herbst hindurchzieht, in dem es Larissa langsam wieder besser geht, durch den Winter, der sich ewig hinstreckt, weil dann beide immer müde und voller Sorgen sind, und im Frühling ganz entspannt den Sprung zurück in den Selbstmordsommer ansetzt. Ob es nicht besser wäre, wenn dieser Kreislauf endlich sein Ende finden würde.
Das überlegt sich die beste Freundin von Larissa noch auf ihrem Nachhauseweg, während ihre Schlappen im heissen Teer einsumpfen und während sie auf dem Balkon die letzte Zigarette des Abends raucht und dann, während sie im Bett liegt, sich in den heissen Laken hin und her wälzt, nur um doch noch mal aufzustehen, sich vor den Laptop zu setzen und zu rauchen.
Larissa liegt währenddessen bei sich auf dem Boden herum, manchmal blutend, manchmal nicht, nie genug blutend, um zu sterben, immer zu müde, um zu existieren, starrt die Decke an, bis ihr schwarz vor Augen wird, und wacht morgens mit getrocknetem Blut auf beiden Unterarmen wieder auf und fragt sich, ob das wirklich ein Tag werden wird, den sie erleben möchte. Sie schliesst die Fensterläden und blickt davor noch einmal in die leere Altstadt unter ihr. Die Pflastersteine zu nahe, als dass sie Sterbehilfe leisten könnten, höchstens querschnittgelähmt könnten sie sie machen, und das braucht sie nun wirklich nicht auch noch. Pflastersteine sind eh dumme Dinge, denkt sie, als sie die Fensterläden und dann das Fenster schliesst und sich unter die Dusche stellt. Sie untersucht die Rasierer ihrer Mitbewohnerinnen und benutzt dann einen rosafarbenen, um sich die Achseln zu rasieren. Ihr eigener Rasierer mit den Rasierklingen liegt bei ihr im Zimmer auf ihrem Waschbecken. Sie dreht den Wasserhahn auf eisig kalt, schreit beinahe auf vor Schreck, atmet laut, stellt das Wasser wieder ab und trocknet sich mit einem Handtuch. Ihr Pony klebt an der Stirn, die restlichen Haare stehen in alle Richtungen ab. Auch das Bürsten hilft nur so halb. Dann versucht sie die Haare mit Klammern zu bändigen und wird wütend, weil es nicht funktioniert. Erst wenn sie schnaubend vor dem Spiegel steht und ihr eigenes Bild nicht mehr erträgt, sprayt sie ein bisschen Desinfektionsmittel auf die halboffenen Wunden am Arm, holt sich einen Verband und verbindet sich die Arme. Sie geht zurück ins Zimmer, findet das Kleid vom Vortag, wirft es sich über, zieht dann ein kariertes Hemd, das die Arme verdeckt, darüber an.
Immer im Sommer versucht Larissa sich umzubringen, aber nie klappt es. Auch wenn es schon einige Male sehr knapp wurde, auch wenn schon einige Male die Intention echt und da war. Und nicht nur der Drang bestand, sich die Arme aufzuschneiden, weil ihr das dieses Gefühl der Erleichterung gibt, das Gefühl, endlich etwas richtig zu machen, indem sie etwas Kaputtes noch mehr kaputt macht. Was ja richtig ist, dass man kaputte Dinge wegschmeissen sollte und den Müll wegbringen muss, deswegen ist es auch richtig, wenn sie sich selbst aufschneidet und sich dann da liegen lässt und wartet.
Immer im Sommer, wenn Larissa ihre Bahnen im leeren Hallenbad schwimmt und es draussen gewittert, denkt Larissa gar nichts mehr, spürt nur die Anstrengung in den Armen und Beinen, die sich durchs Wasser prügeln. Aber heute kann sie nicht ins Hallenbad, weil ihre Arme zerschnitten sind. Stattdessen liegt sie in der angestauten Hitze ihres Zimmers hinter geschlossenen Fensterläden am Boden, die Lampe surrt leise über ihr, ihre Arme pulsieren noch, aber das geht vorbei, das kennt sie ja bereits. Das kennt sie bereits, wenn ihr Handy neben ihr vibriert und sie nicht draufguckt, wer ihr geschrieben hat, wenn sie den Laptop öffnet und wieder schliesst, weil ihr einfällt, dass sie panische Angst hat vor den Nachrichten, die auf Facebook auf sie warten, wenn ihr einfällt, dass sie die äussere Welt um jeden Preis ausschliessen muss, fällt sie in die Stille des Raumes hinein; immer im Sommer, wenn sie drei Monate lang nicht zur Schule muss, fällt Larissa in Räume hinein und kommt nicht mehr raus. Dann schliesst etwas in ihrem Kopf und etwas schiesst auf sie, auf die Leichtigkeit des Sommers, die sie zu Boden drückt. Die sie erstickt und atemlos zurücklässt.
Dass sie das niemandem so richtig erklären kann, nicht mal ihrer Psychiaterin, diesen versuchten Tod aus Langweile, diesen Selbstmord, weil es nichts mehr zu tun gibt in der schwülen Zeit, die sich über den See und die Berge dahinter wie ein fetter Schinken legt, damit hat Larissa sich abgefunden. Dass es dafür keine Gründe gibt, das weiss Larissa, das ist ja auch egal. Sie weiss nicht, warum im Sommer ihre Gedanken nass werden, so dass sie sich an den Rändern wellen und dünn werden, warum ihr ganzer Sommer sich in diesem gelbgrauen Ton verfärbt, sich über die Wäscheleine hängt und auf den Boden tropft. Darunter sitzt ein Hund mit nassem Fell und schüttelt sich in unregelmässigen Abständen. Larissa sitzt daneben, ihr Kleid wird nass davon, die eigene Haut darunter, heiss von der Sonne, verschimmelt langsam. Ihre Oberfläche wird weich und schleimig, überall dort, wo sie sie aufgeschnitten hat. Dann wird ihr Kopf trüb und wässrig, bis sie das Gefühl hat, keine Luft mehr zu kriegen, dann wird sie verfolgt von den Dingen, die sich um sie herum bewegen, dann schlägt sie nach allem, was sie berührt. Ihre Hände zittern dabei. Sobald auch ihre Arme anfangen zu zittern, beginnt sie ihre Umgebung zu durchwühlen, umzuschmeissen, darauf einzuschlagen, so lange, bis sie einen spitzen Gegenstand findet, der sie entlasten kann, der ihre Haut öffnet, der Luft in sie hineinlässt, der etwas von ihrem Gewicht in Freiheit entlässt, so lange, bis sie sich leicht fühlt, ihr Kopf sich klärt und hell wird. Bis sie davon geblendet wird und die Augen schliessen muss, dann wird es schwarz und alles hört auf.
Der Hund legt sich neben Larissa und leckt ihr das Wasser vom Gesicht, das von der Wäscheleine auf sie hinuntertropft. Die verfaulte Haut unter dem Kleid wird die Insekten anziehen, bald schon, die Sonne steht noch hoch, unter ihren Füssen vertrocknet das Gras. Es ist ein Jahrhundertsommer, aber auch er wird zu Ende gehen.