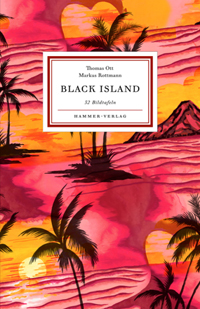Gute Helden, schlechte Literatur
Seit es Literatur gibt, gibt es Kriegsgeschichten. Am besten sind jene, die auf Einzelpersonen fokussieren – ohne sie zu Helden zu stilisieren. Sagt Charles Lewinsky, der in seinen Romanen versucht, die nicht erlebte Kriegszeit «wahr» zu erfinden. Ein Gespräch über das tragische Schreiben von glücklichen Nachgeborenen.

Herr Lewinsky, Sie sind 1946 geboren, kurz nach dem Krieg, mit dem Sie sich in Ihren letzten Romanen intensiv beschäftigt haben. Was fesselt Sie an dem Thema, welche persönliche Beziehung haben Sie zu ihm?
Kann man eine persönliche Beziehung zur Pest haben? Die Menschheit neigt dazu, in regelmässigen Abständen wahnsinnig zu werden. Mehr will ich zum Krieg nicht sagen, denn ich muss gleich protestieren: Ich habe mich intensiv mit der Weimarer Republik befasst, einer sehr spannenden Zeit. Da galt quasi über Nacht plötzlich Altbekanntes nicht mehr. Mit dem Krieg beschäftige ich mich dagegen kaum. Er ist bloss das böse Ende jener Zeit, die mich interessiert. Und doch werde ich dauernd auf dieses Thema angesprochen!
Das dürfte damit zu tun haben, dass der Zweite Weltkrieg re-spektive dessen Auswüchse (Propagandafilme) und Einrichtungen (Ghettos) in Ihren Romanen – «Kastelau» und «Gerron» – den prägenden Hintergrund bilden.
Es hat vor allem damit zu tun, dass die Leute immer die schlimmste Entwicklung als Ausgangspunkt nehmen und Geschichten im allgemeinen vom Ende her denken. Man konnte das jüngst beobachten: In England etwa sind dieses Jahr grauenhaft viele Artikel über junge Dichter erschienen, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind. Die Dichter wurden darin auf die Tatsache reduziert, dass sie im Krieg gestorben sind. Ihr Leben davor fiel schlicht aus dem Bild. Das ist eine Verzerrung, die sich scheinbar zwangsläufig ergibt, wenn man über die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts schreibt – denn es ist unmöglich, über diese Zeit zu schreiben, ohne den Krieg zu thematisieren. Auch wenn man ihn nicht ins Zentrum rückt: Man kommt wohl nicht um ihn herum.
Auch nicht als Schriftsteller aus einem Land, das es geschafft hat, um den Krieg herumzukommen?
Durchgemogelt haben wir uns! Während der Zeit des «Dritten Reiches» hat sich die Schweizer Regierung nie heldenhaft verhalten. Sie hat sich ein wenig in die, ein wenig in die andere Richtung verbogen und sich allen ein klein wenig nützlich gemacht. Und damit hat sie dem Land Gutes getan. Sicher wäre es heldenhafter gewesen, die Zusammenarbeit mit dem «Dritten Reich» zu verweigern – nur wären dann die Deutschen einmarschiert und hätten die Zusammenarbeit erzwungen. Wobei zusätzlich einige Prozent der Schweizer Bevölkerung gestorben wären. – Manchmal ist es eine Tugend, kein Held zu sein. Die Forderung nach Heldentum ist unfair.
In Ihrem Roman «Kastelau» wird aber gerade Heldentum eingefordert. Das Ende des «Dritten Reiches» ist absehbar, und eine Filmcrew beschliesst, in den Bergen einen Durchhaltefilm zu drehen, um der Berliner Bombengefahr zu entkommen. In einer Filmszene sagt einer zu seiner Mutter, er wolle sein Leben für das Vaterland geben. Schliesslich sei er ja bloss ein Rädchen im Getriebe. Das wirkt auf den Leser wie eine Parodie, aber warum bloss?
Weil es sich um einen furchtbar künstlichen Filmhelden handelt! Die pathetische Filmszene wirkt gelesen bloss lächerlich, und das soll sie auch. Ich wollte das Heldentum entlarven. Helden brauchen extreme Vereinfachungen, und Vereinfachungen sind gefährlich. Zudem sind sie auch nicht überzeugend: Nennen Sie mir ein Buch mit einem reinen Helden, das überdauert hat! Reine Helden sind schlechte Literatur, weil sie schlechte Wirklichkeit sind.
Aus dem Nazi-Helden wird in Ihrem Buch daraufhin ein Widerstandskämpfer: Die Szene wird am Schluss neu gedreht, um die Amerikaner zu täuschen. Statt für das Vaterland wird nun für die Freiheit gestorben. Die Argumentation bleibt dieselbe.
Und das soll sie auch, denn ich wollte zeigen, dass die Dinge manchmal näher beieinanderlagen, als man meint. Im nachhinein ist es ja immer einfach, von klaren Schwarz-Weiss-Mustern auszugehen. Dann beanspruchen plötzlich alle, auf der richtigen Seite gestanden zu haben. In Deutschland haben der Legende zufolge mehr Leute einen Juden im Keller versteckt, als es in Deutschland Keller gab. Trotzdem hat es niemand überlebt. Komisch. Jedes Land baut sich Heldenlegenden, in denen sich die Leute einrichten können, und der Sieger bestimmt, welche gelten.
Die Schweizer Legende lautet, dass wir die Insel der Seligen sind. Die letzten fremden Truppen waren unter Napoleon im Land. Sie waren nie im Krieg und wuchsen in einer Demokratie auf: Wie denkt man sich mit so einer Biographie in das Kriegszeitalter ein?
Man muss Dinge nicht erlebt haben, um sich in sie einfühlen zu können. Wenn man nur über das schreiben könnte, was man
erlebt hat, wären ja alle Krimiautoren grausame Menschen! Nehmen wir an, Sie sind mit dem Auto unterwegs und warten auf einen freien Parkplatz. Und gerade als einer frei wird, kurvt jemand vor ihnen rein und schnappt sich den Platz. Wenn Sie dieses Gefühl nehmen und für sich vergrössern, können Sie nachher einen Mörder beschreiben, ohne dazu jemand umbringen zu müssen. Oder denken Sie an einen Schüler, der gemobbt wird, weil er schwul ist. Wenn er nach Hause kommt, sagt ihm sein Vater: «Du musst dich halt wehren.» Dieser Schüler kann eine Kriegssituation sehr exakt nachempfinden.
Sie recherchieren für Ihre historischen Romane auf dem Parkplatz?
(lacht) Mitunter! Im Ernst: ich unterscheide zwei Arten der Recherche: die wissenschaftliche und die Autorenrecherche, die ich gerne «Blauwalrecherche» nenne. Der Blauwal pflügt sich mit offenem Schlund durchs Meer und lässt Hektoliter Meerwasser durch sich fliessen – und ab und zu bleibt ein Krebslein an einem seiner Barthaare hängen. So macht es auch der Autor: Er ist nicht auf der Jagd nach etwas Bestimmtem. Schreibt er über einen gewissen Zeitraum, versucht er, sich jede Quelle über diese Zeit anzusehen. Am Ende und im Text bleiben davon nur kleine Details hängen. Von einem dicken Buch über die deutsche Okkupation von Holland etwa, das ich während der Arbeit an «Gerron» gelesen habe, blieben effektiv nur drei Zeilen übrig, die ich wirklich verwendete – die waren dafür umso durchdringender. Es handelte sich um die Deportation einer Gruppe von Geisteskranken, denen man nicht klarmachen konnte, weshalb sie die Finger aus der Türangel nehmen sollten – weshalb dann die Eisentür des Viehwagens über ihren Fingern geschlossen wurde.
Wenn die Recherche auch immer ähnlich abläuft, so sind die Resultate, zu denen Sie dadurch kommen, formal gesehen doch sehr unterschiedlich. Sie haben in der Vergangenheit verschiedenste Mittel ausprobiert, um sich dem Krieg anzunähern: In «Gerron» gehen Sie von einer realen Biographie aus und verwandeln sie in Fiktion. In «Kastelau» erzählen Sie von fiktiven Schauspielern, die alles tun, um zu überleben, und untermauern die Geschichte mit fingierten, Authentizität vortäuschenden Dokumenten wie etwa Wikipedia-Einträgen. Was reizt an diesem Spiel mit den Formen?
Ich würde weder von «Ausprobieren» noch von «Spiel» reden. Ich glaube, es gibt zwei Arten von Schriftstellern. Die einen haben eine bestimmte Form, in die sie alles, was sie schreiben, hineinpassen. Wenn Sie fünf Zeilen Thomas Mann lesen, wissen Sie sofort, dass das Buch von ihm ist. Und dann gibt es die anderen, zu denen ich mich zähle: Ich suche für jede Geschichte eine entsprechende Form. «Melnitz» zum Beispiel war ein Buch mit einem allwissenden Erzähler. Der hat Zeit, lange Sätze zu bilden und schöne Metaphern zu suchen. Bei «Kastelau», in dem es zentral um das Vortäuschen von Wirklichkeit geht, sollte die Form ebenfalls Wirklichkeit vortäuschen.
In «Kastelau» gaukelt eine Filmcrew den Bewohnern eines bayrischen Bergdorfes vor, einen Film zu drehen, obwohl nur ein paar Szenen produziert werden. Sie machen also Ähnliches, wenn Sie den Leser mit fragmentarischen Szenen dazu verleiten, an eine runde, wahre Geschichte zu glauben.
So kann man es sagen. Wenn ich eins zu eins erzähle, ist der Autor spürbar. Setze ich einen Roman aber aus lauter scheinbar authentischen Fragmenten zusammen, wirkt das Ganze viel
realer. Wenn Sie die fiktiven Wikipedia-Einträge in meinem Roman lesen, denken Sie: «Wenn es in Wikipedia steht, wird es schon stimmen.» Auf die Weise hoffe ich, die Leute dazu zu
bewegen, darüber nachzudenken, was Wirklichkeit ist und was nur vorgetäuscht wird.
Gefilmt und in diesem Sinne «Welt inszeniert» wurde auch schon in «Gerron». «Filmen heisst lügen», heisst es dort dann einmal. Was heisst Schreiben?
Schreiben heisst natürlich auch lügen. Literatur erzählt Geschichten, und alle Geschichtenerzähler sind Lügner: Schriftsteller sind die Lügner mit der höchsten gesellschaftlichen
Akzeptanz. Bei den besten Autoren werden diese Lügen von nachfolgenden Generationen für wirklicher gehalten als die Wirklichkeit selbst: Denkt man an das viktorianische England, so denkt man an Charles Dickens. Und hat das Gefühl, das viktorianische England sei genau so gewesen, wie er es beschreibt.
Seit je schon haben sich die approbierten Lügner auch mit dem Krieg befasst: Literatur und Krieg gingen schon bei Homer und Herodot zusammen…
Natürlich. Man schreibt über das, was einen bewegt. Dabei ist «der Krieg» als Gesamtphänomen unmöglich beschreibbar. Gerade bei Homer sieht man das sehr schön: Er beschreibt nicht die Schlacht um Troja, sondern einzelne Kämpfe vor Troja. Er dampft den Krieg auf Geschichten ein – und anders kann man ihn bis heute nicht transportieren. Wenn wir hören, dass 6 Millionen Juden im Holocaust ermordet worden sind, können wir uns das nicht vorstellen. Anne Frank aber können wir uns vorstellen. Gute Bücher über den Krieg sind deshalb immer personenbezogen. Die Hauptfigur ist dabei nie ein «Held», sondern, genau wie bei Homer, eine Person mit Fehlern und Schwächen.
Freilich sind auch heldische Kriegsdichtungen keine Seltenheit: Bücher, die Kämpfer glorifizierten und dadurch den Krieg verherrlichten, sind zuhauf erschienen. Wie verhindert man, dass Literatur oder Kunst zu Propagandazwecken missbraucht wird?
Das ist unmöglich zu verhindern. Das einzige, was man selber beim Schreiben tun kann, ist, zu versuchen, immer nur ehrlich zu lügen.
Was heisst das?
Das heisst, dass man in seinen Fiktionen versuchen soll, die Dinge und Figuren richtig zu erfinden. Ein Beispiel: in meinem Roman hat Kurt Gerron eine kriegsbedingte Keimdrüsenverletzung und wird deshalb unfruchtbar und dick. Nirgends ist belegt, dass das der Fall war. Man weiss folgendes: Gerron hatte eine Kriegsverletzung, ist unförmig dick geworden, war glücklich verheiratet, galt als kinderlieb, blieb aber kinderlos und hat noch in Theresienstadt Macho-Witze gerissen. Diese unterschiedlichen Elemente haben mich zur Überlegung gebracht, dass «Impotenz» all diese Dinge gleichzeitig erklären würde – denn für Macho-Witze gibt es kaum einen besseren Grund als Impotenz! Kurz: ob Gerron impotent war oder nicht, wissen wir nicht. Dennoch stimmt meine Annahme, denn sie widerspricht ihm nicht. Und damit ist sie ehrlich erlogen.
Apropos Witz: sowohl in «Kastelau» als auch in «Gerron» muss man bei der Lektüre zuweilen schmunzeln, vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs respektive des Ghettoalltags
spielen und stehen immer wieder komische Szenen und sarkastische Sätze. Geht das nicht gegen den guten Geschmack?
Nein, das muss so sein! Nehmen wir nochmals Gerron. Man hat ihm den Beruf genommen, man hat ihm das Geld genommen und am Schluss das Leben. Soll ich ihm jetzt posthum auch noch den Humor wegnehmen? Das wäre die schlimmste Strafe! Ein äusserst witziger Mensch wird ja nicht weniger witzig
dadurch, dass man ihn ermordet; man kann einen Menschen nicht vom Ende her erklären.
Tatsächlich erklären Sie ihn ja von Anfang an: Als Schriftsteller «erlügen» Sie die gesamte Biographie des in Auschwitz ermordeten Regisseurs und erzählen sein Leben neu, und zwar aus der Ich-Perspektive. Hatten Sie keine Skrupel, sich die Stimme dieses Menschen zu leihen? Oder anders gefragt: Darf Literatur alles?
Nein, alles darf sie nicht. Aber wenn man ehrlich lügt, darf man ziemlich viel. Und ich hatte gar keine andere Wahl, als «Gerron» in der Ich-Form zu verfassen. Ein aussenstehender Erzähler hätte im zentralen Dilemma des Buches – im Ghetto wird Gerron vor die Wahl gestellt, einen Propagandafilm über Theresienstadt zu inszenieren oder direkt nach Auschwitz
deportiert zu werden – Position beziehen müssen. Ich meine aber, dass wir als glückliche Nachgeborene nicht das Recht haben, ein Urteil abzugeben. Weil ich als Autor nicht Partei ergreifen wollte, bin ich automatisch auf die Ich-Form gekommen.
Berichte über Ghettos und Konzentrationslager gibt es zahlreiche aus erster Hand. Was leistet demgegenüber die Fiktion eines spätgeborenen Verschonten?
Nun, ich schreibe ja im Vergleich zu solchen Zeugnissen eine ganz andere Geschichte, in der – im Falle von «Gerron» – nicht der Holocaust im Zentrum steht, sondern das Leben eines Menschen, der die ganze Welt als Theater sieht – und das auch zuletzt im Ghetto noch tut. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass man als Spätgeborener auch weitergehen und zum Beispiel fiktiv über Auschwitz schreiben darf. Das ist natürlich sehr viel schwerer, ich zum Beispiel würde mir das nie zutrauen. Weil ich nicht ehrlich darüber schreiben könnte, das heisst: weil ich mich nicht richtig in die Grausamkeit reinleben und also nicht «wahr» erfinden könnte.
Wo zwischen Theresienstadt, das noch beschreibbar war, und Auschwitz, das nicht mehr ginge, liegt denn für Sie die Grenze, bis wohin können Sie sich hineindenken? Wo wird das Nachempfinden unmöglich?
Das ist sehr schwer zu sagen. Klar ist einzig, dass es sich nicht um eine moralische Grenze handelt, sondern um eine Frage der schriftstellerischen Fähigkeit. Einen Roman über eine jüdische Familie kann ich jederzeit schreiben, denn ich weiss, wie es dort riecht, und zwar im Detail! Aber dann gibt es Dinge, die ich einfach nicht schaffe. Die sind aber von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ein grosser Dichter kann Auschwitz so erfinden, dass es echt ist. Ich kann es nicht. Also mache ich es nicht. Viele können es auch nicht und machen es trotzdem, und dann wird Literatur wirklich schlimm. Eine Art Holocaust-Pornographie, die meint, es reiche, sich etwas Schrecken an die Brust zu stecken, um gute Literatur zu produzieren. Das finde ich nicht zum Aushalten. Deshalb ist das einzige Tabu, das ich kenne, kein moralisches, sondern ein qualitatives: Wenn ich etwas nicht kann, lasse ich die Finger davon. Oder streiche es spätestens im Entwurfsstadium – für etwas gibt es am Computer ja die Delete-Taste.