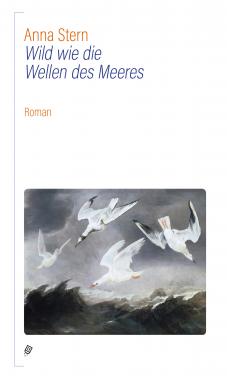«Kenne ich die Geschichte?»
Von einem Glarner Dorf namens Engi in die Weite Chiles. Eine kriminalistische Spurensuche über Kontinente und Zeiten hinweg.

Am Freitag, dem 4. Januar 2013, an einem schönen chilenischen Sommerabend, begrüssen Werner Luchsinger, 75, und seine Frau wie gewohnt die letzten rosigen Sonnenstrahlen auf dem ewigen Schnee des mächtigen Vulkans, weit über ihrem Landgut. Zufrieden blicken sie auf das umfangreiche Gehöft: Weizenfelder, so weit das Auge reicht, riesige Weiden, Speicher, Tannen-, Eukalyptuswälder und Pappelreihen. Orion und das Kreuz des Südens leuchten auf und die Luchsingers ziehen sich in ihr Haus zurück. Es wurde vergrössert, stammt aber noch aus Grossvater Adams Zeiten, der aus der Schweiz gekommen war, um sich hier niederzulassen. Wie jeden Abend legt Werner eine Browning 7,65 x 17 mm auf seinen Nachttisch.
Um zu verstehen, wieso diese Geschichte schlecht ausgegangen war, machte ich mich zuerst auf den Weg nach dem zu Recht Engi genannten Dorf, dem schweizerischen Herkunftsort der Luchsingers, im hinteren Teil eines blinden Tals. Im Telefonbuch fand ich dort neunmal den Namen Luchsinger, darunter einen Automechaniker und einen Hüttenwächter, die weiteren ohne Berufsangabe, jedoch mit den typisch glarnerischen Vornamen Kaspar, Willy, Peter und Hans.
Mit dem Zug aus Genf reiste ich über Zürich bis Schwanden, durch ein Tal zwischen steilen Berghängen. Das Postauto fuhr noch eine halbe Stunde, bis wir in Engi ankamen, vor der Kirche, einem mittelalterlichen Bau aus dicken Mauern mit einer Holzdecke, offener Tür und umgeben von Grabsteinen. Es war ein Herbsttag mit roten Blättern an den Bäumen. Neben dem Eingang, auf einem Stapel Psalter, lag die Zeitung der Kirchgemeinde mit «Asylanten kochen für unsere Gemeindemitglieder» auf der ersten Seite. Ich setzte mich auf eine helle Holzbank und hörte auf die Geräusche der Umgebung: das Muhen einer Kuh, der Motor eines Einachsers am Hang, der klagende Schrei eines Bussards. Draussen beobachtete ich die Reihe der Gräber: eine Serie senkrecht aufgereihter Rechtecke, aus dem leicht zu bearbeitenden regionalen Schieferstein. Der Name Luchsinger kam mehrmals vor.
Ich setzte meine Nachforschungen mit Hilfe des Kirchenbuches fort. Dort sind seit 1689 Söldner der Familie Luchsinger erwähnt, die im Auslanddienst ihr Leben gelassen haben. Es beginnt mit dem im Alter von 35 Jahren gefallenen Adrian Luchsinger. 1709 folgt Friedlis Tod in einer Schlacht im Ausland, mit 24. 1812 sterben Fridolin und die Geschwister Martin sowie ein anderer Fridolin in Russland unter Napoleon, während ihr Cousin David an der spanischen Front im Kampf gegen die Truppen Napoleons ums Leben kommt. 1854 stirbt noch Peter mit 28 Jahren in Neapel.
Zu jener Zeit wurde der fremde Dienst vom Bund verboten, was für die Luchsingers – zu zahlreich, zu viele hungrige Münder in einem so kleinen Dorf – die Auswanderung bedeutete. Sie erkundigten sich und erfuhren, dass die Regierung in Chile die Mapuche-Indianer in den Süden vertrieben hatte und die Niederlassung von europäischen Neuansiedlern mit phantastischen Bedingungen förderte. So zahlte der chilenische Staat den neuen Siedlern aus Europa die Reise- und Niederlassungskosten, zwei Jahre Lohn und jedem 40 Hektar guter Erde, zuzüglich 20 Hektar pro Kind.
Ich kann mir denken, dass man auch in Engi wusste, dass dieses Land den Indianern gehörte. Da diese jedoch keine Eigentumsurkunden besassen und den Krieg verloren hatten, blieben den Angesprochenen angesichts eines so verlockenden Angebots wenig Bedenken. Adam Luchsinger, wie rund 22 000 Deutsche und 8000 Schweizer, unterzeichnete. Das von der chilenischen Agentur versprochene Grundstück lag 25 Kilometer von der Garnisonsstadt Temuco entfernt, wo die Armee weiterhin den «Frieden in Araukanien» förderte. Die Sache wurde mit der Familie besprochen, es war etwas gewagt, aber von nichts kommt halt nichts. Statt in Engi am Hungertuch zu nagen, packte Adam im Frühjahr 1883 seine Sachen und umarmte Mutter, Vater und Cousins, die ihn fragten, wieso er denn die zwei Kühe und einige Hühner nicht mitnehmen wollte.
Über die Reise der Familie habe ich nichts gefunden. Sie sind wohl in Rotterdam an Bord gegangen, haben in Buenos Aires Halt gemacht und Chile über das Kap Horn erreicht. Drei Jahre nach ihrer Niederlassung besuchte der waadtländische Pfarrer François Grin die schweizerische Siedlung. Sein Bericht liegt in Lausanne in der Stadtbibliothek. Gegenüber Adam Luchsingers Praktiken zeigt er sich eher unnachsichtig: «Herr Luchsinger berichtet mir von einem Unfall, der ihm passiert ist: ‹Eines Tages sind sechs Chilenen der Nachbarschaft bei mir erschienen, die um Gastfreundschaft baten. Meine Söhne waren abwesend und ich trug gerade eine Armschlinge. Die Männer sind lange geblieben. Als ich mich auf diese Bank setzte – er zeigt mir einen Holzhocker neben seinem Bett –, setzte sich einer von ihnen neben mich und begann, mich auf Spanisch anzusprechen. Er hatte unbemerkt von mir eine Axt aufgegriffen, die ich gewöhnlich bei der Türe hinter dieser Truhe aufbewahre. Plötzlich holte er die Axt unter seinem Poncho hervor und ehe ich mich versah, verpasste er mir einen heftigen Schlag auf den Kopf. Ich fiel bewusstlos zu Boden. Mein Angreifer wollte mich umbringen und schlug weiter auf mich ein, doch dann riefen die Frauen um Hilfe und die Männer ergriffen die Flucht. Ich brauchte lange, um mich davon zu erholen. Obwohl ich keine schlimmen Verletzungen erlitt, war ich dauerhaft erschüttert …› Später erfuhr ich, dass dieser in vielerlei Hinsicht beispielhafte Mann das Verkaufsverbot für alkoholische Getränke missachtete. Sein Haus war unterdessen zum Treffpunkt der Nachbarschaft geworden. Schuld an dem Ganzen war also der Siedler selbst. Leider ist Herr Luchsinger kein Einzelfall. Die besten unserer Landsleute tun dasselbe.»
Unter den Schweizern in Chile ist es nicht allen gelungen, ihr Land zu behalten. Manche von ihnen machten zuerst aus den Mapuche-Indianern Alkoholiker und wurden es später selbst. Andere liessen sich für den Eisenbahnbau anstellen oder zogen in die Hauptstadt. Die Familie Luchsinger hatte mehr Glück, und drei Generationen später geniessen die Nachkommen der Ansiedler dank Grundstück und Ressourcen eine äusserst komfortable Lebenslage. Und dennoch äusserte sich Adams Sohn Jorge einmal so abschätzig über die Mapuche-Ureinwohner, dass er von der chilenischen Regierung gezwungen wurde, einen Teil seines Grundstücks zu verkaufen.
Von Generation zu Generation, seit 1883, haben die Ansiedler die Ansprüche der Mapuche nie anerkennen wollen. Diese sind inzwischen über eine Million, zwei Drittel davon leben um Temuco herum. Ihre Stimmen sind lauter geworden, bis zur gewaltsamen Konfrontation, mit dramatischen Folgen. Am 4. Januar 2013 brannte Adams Haus nieder. Dabei kamen sein Enkel Werner und dessen Ehefrau ums Leben. Unweit des Tatorts fand die Polizei einen Mapuche-Schamanen mit einer Schusswunde. Nach Aussagen der Polizei hatte sich Werner Luchsinger mit einer Schusswaffe gegen die Brandstifter verteidigt. Die Mapuche-Gemeinschaften ihrerseits leugnen jegliche Beteiligung und sprechen von einer Verschwörung der Ordnungskräfte und rechtsextremistischer Paramilitärgruppen. Tatsächlich wurde nicht bewiesen, dass die Kugel in der Brust des Schamanen aus der Browning 7,65 von Werner Luchsinger stammte. Trotzdem wurde der Mapuche zu achtzehn Jahren Gefängnis verurteilt. Die Siedler fanden dieses Urteil zu mild, sie wollten das Antiterrorgesetz anwenden lassen.
In Genf plädieren die Mapuche regelmässig bei den Vereinten Nationen für ihre Rechte. Als ich einigen von ihnen begegnete, stellte ich ihre Entschlossenheit fest, wie auch ihre Bemühungen um die Anerkennung ihrer Sprache.
Im Januar 2015, als ich Südamerika von Patagonien Richtung Norden auf den Spuren der schweizerischen Auswanderung erkundete, hielt ich in Temuco. Jeden Tag las ich in den Zeitungen vom Kampf der Mapuche-Indianer, die abwechselnd als Sturmhaubenträger, Brandstifter und Terroristen bezeichnet werden. Schon der geringste Waldbrand wird «bewaffneten Männern mit dem Mapuche-Wuchs» unterstellt, obwohl später immer wieder Versicherungsmissbräuche durch Siedler erkannt werden. Auf den Mauern der Stadt las ich Aufschriften für die Befreiung von politischen Gefangenen unter den Mapuche-Indianern. Am Fernsehen war von 29 aus der Kontrolle geratenen Waldbränden die Rede, welche alle «dem Terrorismus» zugerechnet wurden.
Auch die Erklärung von Militza Luchsinger habe ich gelesen, der Nichte des im Hausbrand umgekommenen Paares; sie ist Mitglied des Vereins der schweizerischen Nachfahren in Araukanien. Sie schätzt, dass nahezu 60 Prozent der Familien dritter und vierter Generation den Schweizer Pass besitzen. Die meisten unter ihnen sprechen Deutsch. Für sie öffnete der Bund 2006 ein Konsulat in Temuco. «Meine Vorfahren», sagt Militza, «sind mit den besten Absichten ausgewandert. Es wurden Kolonien gebildet, das Banditenwesen wurde gebändigt, die Gegend ist zur Kornkammer des Landes geworden, und nun werden wir von Banditen verfolgt.»
Von Temuco fuhr mich eine chilenische Freundin mit dem Auto bis ins Dorf, wo das Grundstück der Familie Luchsinger liegt. Ich war beeindruckt von der unglaublich fruchtbaren Natur, den riesigen Weizenfeldern und endlosen Weiden mit gewaltigen Kuhherden. Die grossen Grundstücke der Ansiedler waren leicht zu erkennen durch die Schilder «Frieden in Araukanien».
Im Dorffriedhof ist mir das Grab der Familie Frei aufgefallen, schweizerischer Auswanderer, die Chile zwei Präsidenten schenkten. Meiner Freundin erklärte ich: «Auch ich bin Schweizer. Ich möchte das tragische Schicksal dieser Zwangsauswanderer verstehen.»
Ich hätte eine Geschichte erfinden können, ein Western, in dem die Indianer eine ganze Nacht lang eine Farm belagern, bis bei Sonnenaufgang ein Cowboy mit der Waffe in der Hand tot am Boden liegt. Es würde die Guten geben, die Schlechten, Schuldige und Helden. Das war einmal ein Projekt, auf das ich verzichtet habe.
Auf dem Rückweg lassen wir den im Abendlicht rosig schimmernden Vulkankegel hinter uns. Ich bewundere noch einmal die so fruchtbare Natur und spiele mit dem Gedanken, wie eine simple Umkehrung mancher stolzen Behauptung einen neuen Sinn schenken würde, etwa wie aus «Ich kenne die Geschichte» die Frage entstünde: «Kenne ich die Geschichte?»
Daniel de Roulet (Text)
ist Schriftsteller. Zuvor war er Architekt und arbeitete als Informatiker. Zuletzt von ihm in Deutsch erschienen: «Zehn unbekümmerte Anarchistinnen» (Limmat, 2017). Er lebt in Genf.
Gideon Urbach (Übersetzung)
ist Übersetzer und arbeitete zuvor als Lehrer und Informatiker im Bildungswesen. Er lebt in Genf.